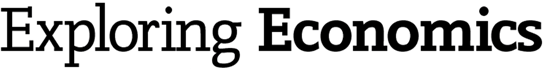Inflation
Exploring Economics, 2022
Inflation
Autoren: Alexander Barta, Jorim Gerrard, Jakob Steffen & Frieder Zaspel
Was ist Inflation? Warum ist sie relevant? Und gibt es eine einheitliche Theorie über ihre Wurzeln und Ursachen, oder ist sie ein umstrittenes Konzept? Genau darum geht es in diesem Text: Wir definieren, was Inflation eigentlich bedeutet, bevor wir uns mit einem interdisziplinären und pluralistischen Ansatz in die theoretische Debatte stürzen: Wie entsteht sie, welche Faktoren können sie beeinflussen, und was kann man dagegen tun?
Inflation
Sie ist einer der wichtigsten makroökonomischen Parameter und als solches Gegenstand einer oftmals hitzigen Debatte über ihre Ursprünge, Gefahren und möglichen Gegenmittel: Die Inflation und ihr nicht minder problematischer Cousin, die Deflation.
In ihrer grundlegendsten Definition bedeutet Inflation schlicht steigende Preise, nicht mehr und nicht weniger. Alle übrigen Aussagen, die meist mit dem Begriff in einem Atemzug gemacht werden – also z.B. ein Zuviel an Geld, das herumschwirre oder aber zu wenige Arbeitskräfte, die aktuell am Arbeitsmarkt verfügbar seien (und damit, zynisch umgekehrt betrachtet, zu wenige Arbeitslose), entwertetes Papiergeld, etc. – sind bereits Bestandteil spezifischer Theorien zur Inflation und ihrer Entstehung und sollten zunächst von der nüchternen Statistik getrennt bleiben.
Also: Inflation bezeichnet steigende Preise im Allgemeinen, also über die gesamte Volkswirtschaft betrachtet, so wie Deflation sich auf fallende Preise bezieht. Sekunde, ist Letzteres nicht sogar etwas Wünschenswertes? Gibt es nicht (fachkundige) Leute die sagen, dass die richtige Sorte von Deflation tatsächlich zu begrüßen sei? Und streben die meisten Zentralbanken nicht umgekehrt eine milde, aber von Null verschiedene Inflation irgendwo zwischen einem und zwei Prozent an? Nun, auch das ist schon wieder alles von der Theorie hinter den Fakten beeinflusst.
Na schön, was ist denn dann der Punkt bezüglich Inflation und Deflation? Der Punkt ist dies: Alle Preise für Güter und Dienstleistungen sind Geldpreise (oder, wie Ökonom*innen es ausdrücken, Nominalpreise). Sie beschreiben, was an Geld im Austausch gegen die Ware oder Dienstleistung aufgebracht werden muss. Nun muss man natürlich Geld ausgeben, um sich Dinge kaufen zu können; was ist bitte so besonders an dieser Trivialität?! Nun, so ziemlich Alles, jedenfalls vom Standpunkt ökonomischer Theorie aus betrachtet.
Bevor wir also voll in die theoretische Debatte zwischen verschiedenen Denkschulen der VWL einsteigen, ist es hilfreich eine Art Vorwort des bekannten Wirtschaftshistorikers Adam Tooze (2021) einzubinden, um eine schärfere Definition des Begriffs der Inflation zu erreichen:
„Soweit sie über Inflation diskutiert, abstrahiert die Ökonomik von idiosynkratischen Schocks. Inflation wird definiert als ein genereller Aufwärtsdruck auf alle Preise, unabhängig von idiosynkratischen Angebotsschocks. Inflation ist in diesem Sinne ein makroökonomisches, aggregiertes Konzept. Die einzig echte allgemeine Bezugsgröße wirtschaftlicher Aktivität ist das Geld. Güter tauschen gegen Geld. Es ist also stets in Bezug zum Geld, dass ein Druck, der sich auf die Preise aller Güter auswirkt, als Inflation definiert wird. In der Tat bezog sich der Begriff ‚Inflation‘, wie Rebecca L. Sprang uns in einem typisch brillanten Kommentar erinnerte, zuallererst auf eine Dehnung der Währung, als er in den 1860er und 1870er Jahren in einem ökonomischen Kontext erstmalig verwendet wurde – und nicht etwa auf die Preisänderungen, die aus dieser monetären Expansion folgen mochten. Es war die Währung, die inflationierte, nicht die Preise.“
Auf der Grundlage dieser Beschreibung gelangt Tooze (2021) zu der folgenden Definition:
„Inflation kann also definiert werden als eine Verschiebung des Tauschverhältnisses zwischen (1) Geld und (2) Gütern, wie es (3) von einer bestimmten Personengruppe erfahren wird und (4) durch einen bestimmten statistischen Apparat erfasst wird.“
Schließlich ist es wichtig zu beachten, dass bereits die Messung der Inflation, also die Festlegung eines Warenkorbs dessen Preise zu Grunde gelegt werden ebenso wie die Berechnungsmethoden der Statistik, notwendigerweise ein selektiver, theoriegeleiteter und mitunter regelrecht politischer Prozess ist: Es gibt nicht so etwas wie die eine, objektive Inflation. Auch hier bietet Adam Tooze (2021) eine denkwürdige Klarstellung:
“Die Wahl eines statistischen Indikators ist nicht nur eine Sache des Designs, also die Wahl des Warenkorbs etc. Statistische Indikatoren müssen produziert werden. Ihre Produktion benötigt Arbeit und Kapital. Sie involviert Technologie. Die Mobilisierung dieser Ressourcen und ihre konkrete Anwendung bedingt die Ausübung von Macht: Bereits die Gewinnung des Daten-Rohmaterials geschieht mittels der Ausübung staatlicher Autorität, entweder mittels Gesetzen oder anderen Formen der Überzeugung bzw. des Zwangs. Daten sind ein Geschäft. Daten sind politisch. Und das ist von besonderer Relevanz im Zusammenhang mit der Inflationsmessung, denn verschiedene ‚Inflationen‘ sind umstritten. Sie erzeugen Gewinner und Verlierer. Das ist der Grund, warum wir uns für Inflation interessieren. Die Gewinner sehen es womöglich nicht gerne, wenn ihre Gewinne dokumentiert werden. Verlierer dagegen werden ihre Verluste dokumentiert sehen wollen, um Schadenersatz anmelden zu können. Inflationszahlen sind nicht einfach nur deskriptiv. Sie sind selbst Bestandteil der politischen Ökonomie des Prozesses, den sie beschreiben. Soweit es um Inflationsmessung geht, existieren frei nach dem großen Ethnomethodologen Harold Garfinkel ‚gute Gründe für schlechte Daten‘.“
Und damit sind wir startklar, um in die theoretische Debatte abzutauchen. Für einen ersten Überblick über die Faktoren, die aus der Sicht der hier diskutierten ökonomischen Denkschulen die Inflation treiben, dient die folgende Tabelle:
|
Denkschule |
Geld- |
Kapazitäts-auslastung/ |
Erwartungen |
Kostendruck (v.a. Löhne) |
Nachfragesog |
Widersprüchliche Forderungen |
Markup policies |
| (Neo-)klassiche Theorie |
x |
|
|
|
|
|
|
| Neukeynesianische Theorie |
x |
x |
(x) |
(x) |
(x) |
|
|
| Post-Keynesianische Theorie |
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
Modern Monetary Theory |
|
|
|
x |
(x) |
x |
|
|
Politische |
x |
|
|
|
|
x |
(x) |
| Soziologische Theorie |
|
|
(x) |
x |
|
x |
|
(Neo-)klassiche Theorie/Monetarismus
„Die Hyperinflation ist nahe – die Zentralbanken drucken Geld wie nicht gescheit,“ ist eine These, die stets seit der Finanzkrise von 2008/09 zu hören und zu lesen ist. Viele Vertreter dieser These stehen unter dem Einfluss des klassischen Monetarismus. Sie sehen den Grund für steigende Preise in einer Ausdehnung der Geldmenge durch die Zentralbanken über ein angemessenes Maß hinaus. Das theoretische Konzept hinter diesem Denken ist die sog. Quantitätstheorie des Geldes: Gegeben eine kurzfristig fixe Menge an realen Gütern und Dienstleistungen kann die Ausdehnung der Geldversorgung nur die Preise anheben. Dies ist die direkte Folge der übergeordneten Vorstellung vom Geld als ‚neutralem Schleier‘: Eine Ökonomie wird determiniert durch ein System an realen Relativpreisen, die durch das Geld nicht beeinflusst werden; letzteres beeinflusst lediglich die aggregierte nominale Nachfrage (vgl. zu diesen Konzepten sowie die neoklassische/monetaristische Theorie der Inflation im Allgemeinen Anderegg 2007).
Das damit in Verbindung stehende Fundament, auf dem alles (neo-)klassische makroökonomische Denken beruht, ist das sog. Say’sche Gesetz: Jedes Angebot schafft sich automatisch seine eigene Nachfrage. Das System von Märkten in einer Volkswirtschaft wird durch den „Walras‘schen Auktionator“ dergestalt organisiert, dass alle Märkte stets zu bestimmten, realen Relativpreisen geräumt sind, der Arbeitsmarkt mit eingeschlossen. Jedwede Arbeitslosigkeit muss dann logisch freiwilliger Natur sein, und Geld dient lediglich der Vereinfachung des Austauschprozesses zwischen Angebot und Nachfrage.
Wenn man diese Elemente zusammennimmt, dann erschließt sich das Herzstück makroökonomischer Modellierung sowohl von vielen Zentralbanken als auch Wirtschaftsjournalisten und Regierungen: Das Phillipskurven-Modell (vgl. z.B. Mankiw 2019). In diesem Modell wird eine systematische, inverse Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation postuliert; d.h. ist die Arbeitslosigkeit erhöht, so ist die Inflation tendenziell niedrig und vice versa. Das heißt, die Menge an Arbeit, die zum Einsatz kommt, wird durch strukturelle Faktoren am Arbeitsmarkt bestimmt, darunter vor allem anderen der Reallohn. Dieser Arbeitseinsatz zusammen mit dem gegebenen, vorhandenen Kapitalstock bestimmt dann die reale Produktion in einer Volkswirtschaft. Wenn die Arbeitslosigkeit also hoch ist und damit die Menge an eingesetzter Arbeit niedrig, dann kann zusätzliche Produktion einfach durch die Beschäftigung zusätzlicher Arbeitskräfte erreicht werden, ohne dass sich deswegen etwas an den Preisen ändern müsste: Durch die Erhöhung der Beschäftigung schafft sich das zusätzliche Angebot seine eigene Nachfrage, womit das Say’sche Gesetz intakt bleibt. In Richtung Vollbeschäftigung jedoch, das heißt mit einer Arbeitslosenrate, die ihr unteres Limit erreicht (vgl. den folgenden Abschnitt zur neukeynesianischen Theorie im Allgemeinen und der „Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment“ oder kurz „NAIRU“ im Besonderen), stößt die Volkswirtschaft an ihre maximal Produktionskapazität, so dass jede zusätzliche Nachfrage nicht mehr durch zusätzliche Produktion befriedigt werden kann; stattdessen beginnen die Preise zu steigen, um das nominale Angebot (also das Produkt aus der Produktion an realen Gütern bzw. Dienstleistungen und ihren Preisen) mit der nominalen Nachfrage wieder in Übereinstimmung bringen.
Dies ist zusammengenommen die sog. Phelbs-Friedman Theorie der Inflation: Durch die ausschließliche Ausdehnung der Geldmenge und/oder schuldenfinanzierte Staatsausgaben wird die so erzeugte zusätzliche gesamtwirtschaftliche Nachfrage in der langen Frist lediglich Inflation erzeugen, denn das zu Grunde liegende Gleichgewicht am Arbeitsmarkt, das ja durch den Reallohn determiniert ist, bleibt hierdurch völlig unberührt. Im schlechtesten Fall, in dem einige Preise fixiert sind (also z.B. durch strukturelle Inflexibilitäten wie Mindestlöhne o.ä.) lässt ein gedeckeltes Angebot Produktionskapazitäten frei, während die Nachfrage erhöht ist oder sogar durch eine expansive Fiskal- und/oder Geldpolitik noch zusätzlich befeuert wird – voilà Stagflation im Stil der 1970er Jahre, also eine Kombination aus niedrigem oder gar negativem Wirtschaftswachstum und hoher Inflation.
Die Inflation, im krassen Kontrast v.a. zur Post-Keynesianischen Theorie (s.u.) folgt dann niemals lediglich durch den Anstieg des einen oder anderen Faktorpreises in der Produktion, schlicht weil dies lediglich zu einer Rekalibrierung des Systems realer Relativpreise durch den Walras’schen Auktionator führt, nicht jedoch zu einem allgemeinen Anstieg aller Preise. Das bedeutet, dass so etwas wie eine “cost-push-“Inflation z.B. durch einen Ölpreisschock in der neoklassischen Theorie nicht vorstellbar ist: Stattdessen führt dieser Schock, sofern er nicht durch staatliche Eingriffe verzerrt wird, schlicht zu einer reduzierten Nachfrage nach energieintensiven Gütern und Dienstleistungen und dirigiert Ressourcen zur Produktion weniger energieintensiver Güter und Dienstleistungen um, so dass die Märkte anschließend wieder geräumt sind. Zum exakt gleichen, allgemeinen Preisniveau wie zuvor.
Damit hat die (neo-)klassische Denkschule keine andere Erklärung für das Phänomen der Inflation als das Geld; in den berühmten Worten Milton Friedmans (1970), des Urvaters des Monetarismus:
“Inflation ist stets und überall ein monetäres Phänomen.”
In diesem Modell der Welt werden Arbeitskräfte stets ausschließlich in der Höhe ihres Wertgrenzprodukts entlohnt, also das von ihnen erzeugte reale Grenzprodukt multipliziert mit dessen Marktpreisen. Da allgemein atomistische Konkurrenz vorausgesetzt wird – gerade auch am Arbeitsmarkt – kann kein/-e Arbeiter*in (oder Gewerkschaft) für längere Zeit einen höheren Lohn durchsetzen. Somit können auch die Nominallöhne nicht ein wesentlicher Treiber von Inflation sein, da sie durch reale Variablen am Arbeitsmarkt bestimmt werden.
Neukeynesianische Theorie
Oftmals als Fehlbezeichnung betrachtet (jedenfalls aus der Perspektive Post-Keynesianischer Ökonom*innen, s.u.) ist die heutige neukeynesianische Mainstream-Denkschule in der VWL das Ergebnis der sog. Neoklassischen Synthese (vgl. Blanchard 1991; zur neukeynesianischen Theorie im Allg. vgl. z.B. Mankiw 2019). Diese Synthese kombinierte das (neo-)klassische Modell wie oben beschrieben mit bestimmten Elementen der Theorie von John Maynard Keynes. Insbesondere Keynes‘ Analyse, wonach die Nominallöhne und -preise oft aus politischen/technischen Gründen jedenfalls kurzfristig fix sind (man denke an Mindestlöhne, Gewerkschaften, Menükosten etc.), wurde dabei in das (neo-)klassische Modell aufgenommen; etwas, was der (neo-)klassischen Schule grds. völlig fremd ist, da sie ja atomistische Konkurrenz auf allen Märkten ohne staatliche Eingriffe voraussetzt. Damit allerdings wird jedes ‚Überschussangebot’ an Geld, das durch die Zentralbank in die Volkswirtschaft regelrecht gepumpt wird, nur dann zu gesteigerter Inflation führen, falls dieses Geld auch tatsächlich vom Staat oder den Privaten zum Kauf von Gütern und Dienstleistungen verwendet wird. Wird es dagegen etwa zur Gesundung von Bankbilanzen verwendet (wie nach der Finanzkrise geschehen) oder weigert sich der Staat, zusätzliche Ausgaben zu tätigen, bläht das zusätzliche Geld lediglich Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und Immobilien auf (wohlgemerkt nicht unmittelbar das Zentralbankgeld, da diese sog. Reserven ausschließlich auf den Zentralbankkonten der Geschäftsbanken Verwendung finden und nie in den Geldkreislauf darüber hinaus fließen, sondern die durch diese Reserven ermöglichten zusätzlichen Kredite der Geschäftsbanken). Voilà, Vermögenspreisblasen, wie sie seit der Finanzkrise von 2008 vielfach zu beobachten waren.
Ceteris paribus, also vorausgesetzt alle übrigen Faktoren bleiben unverändert, führen Preisschocks aus Umweltkatastrophen, Ölkrisen oder Kriegen in diesem Modell zwar kurzfristig zu Verwerfungen auch des gesamten Preisgefüges und damit zu Inflation, pendeln sich aber langfristig wieder ins allgemeine Gleichgewicht aus. Das liegt vor allem darin begründet, dass die Wirtschaftssubjekte rationale Erwartungen haben: Sie blicken regelrecht durch den kurzfristigen Schock hindurch und korrigieren ihre Erwartungen um die Effekte dieses Schocks, womit sich an den realwirtschaftlichen Determinanten des allgemeinen Gleichgewichts wie im neoklassischen Modell angenommen nichts ändert.
Direkt assoziiert mit dem Konzept der rationalen Erwartungen ist das sog. Goodhart’sche Gesetz, das nach dem britischen Ökonomen Charles Goodhart benannt ist: Goodhart schrieb in den 1970er Jahren (in denen zum ersten Mal für längere Zeit das makroökonomische Phänomen der Stagflation auftrat, also eine Kombination aus hoher Inflation bei zugleich geringem oder sogar negativem Wirtschaftswachstum inkl. hoher Arbeitslosigkeit), dass in dem Moment da ein ökonomisches Aggregat als politische Zielgröße auserkoren wird, wie z.B. die Inflationsrate selbst, dieses Aggregat aufhört ein valides Maß ökonomischer Theorie zu sein. Angenommen die Zentralbank versucht, eine bestimmte Inflationsrate zu garantieren (wie es die meisten Zentralbanken in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich auch getan haben). Haushalte und Unternehmen antizipieren dann die jeweilige geldpolitische Reaktion und verhalten sich entsprechend, sowie die tatsächliche Inflationsrate von der Zielvorgabe abzuweichen beginnt; d.h. steigt die Inflationsrate über die Zielvorgabe, erwarten sie steigende Zinsen und senken demgemäß ihre Kredit- und Investitionsnachfrage bereits heute, was wiederum die Inflation drosselt, und Spiegelbildliches für den Fall, dass die tatsächliche Inflation unter die Zielvorgabe sinkt. Mit anderen Worten: Die vermeintlich neutrale, objektive Inflationsrate wird schon alleine dadurch verändert, dass sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird (Physiker*innen könnten sich hier an die Heisenberg’sche Unschärferelation erinnert fühlen).
In diesem Modell der Welt kann anhaltender Inflationsdruck nur aus einem vollständig leergefegten Arbeitsmarkt resultieren, wenn die Arbeitgeber sich ein Bietergefecht um die letzten verbliebenen Arbeiter*innen liefern. Wird der Faktor Arbeit dieserart zum Flaschenhals, steigt der Preis des Hauptproduktionsfaktors neben Kapital immer weiter und erzeugt dadurch Auftriebsdruck im gesamten Preisgefüge der Volkswirtschaft. Man bedenke, dass dies nur möglich ist weil Arbeitskräfte dann mehr Lohn erhalten, als es ihrem Wertgrenzprodukt wie von der (neo-)klassischen Schule angenommen entspräche; letztere könnte tatsächlich noch nicht mal die Vorstellung eines Bietergefechts um Arbeitskräfte akzeptieren, da die Entlohnung des Faktors Arbeit nach (neo-)klassischer Vorstellung sich nicht nach der relativen Knappheit der Arbeitskräfte selbst richtet, sondern nach deren marginalem Produktionsbeitrag. Dieser fällt im (neo-)klassischen Modell per Definition umso geringer aus, je mehr Arbeit bereits eingesetzt wird (Gesetz der fallenden Grenzerträge).
Insgesamt muss es daher nach neukeynesianscher Vorstellung stets eine gewisse ‚natürliche Arbeitslosigkeit‘ oder, in modernen Begriffen ausgedrückt, eine „Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment“, kurz „NAIRU“ geben: Solange die Arbeitslosigkeit für längere Zeit oberhalb der NAIRU verharrt, neigen die Güter- und Dienstleistungspreise zu einer fallenden Tendenz, da es kein Bietergefecht um Arbeitskräfte gibt und also die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer*innen schwach ist. Liegt die Arbeitslosenrate dagegen längere Zeit unterhalb der NAIRU, folgt daraus unweigerlich Inflation.
Bleibe auf dem Laufenden!
Abboniere unser automatisches Content Newsletter, um keine neuen Beiträge mehr zu veerpassen! Außerdem kannst du den Newsletter des Netzwerk Plurale Ökonomik abbonieren.
Exploring Economics Plurale Ökonomik
Post-Keynesianische Theorie
Im Gegensatz zum (neo-)klassischen ebenso wie neukeynesianischen Modellen der Welt gibt es in der Post-Keynesianischen Theorie kein einziges, stabiles makroökonomisches Gleichgewicht (wenn es denn überhaupt eines gibt). Im Besonderen gibt es keine Garantie, dass das flüchtigste aller makroökonomischen Ziele, nämlich ein allgemeines Gleichgewicht inklusive Vollbeschäftigung anders erreicht werden kann als durch blanken Zufall. Dies zerstört unmittelbar das Say’sche Gesetz, wie oben im Abschnitt zur (neo-)klassichen Theorie eingeführt: Wenn ein stabiles allgemeines Gleichgewicht nicht garantiert ist und damit nicht alle Märkte zu jedem Zeitpunkt geräumt sind, schafft sich ein zusätzliches Angebot eben nicht automatisch seine eigene Nachfrage (zur Post-Keynesianischen Theorie im Allgemeinen vgl. Arestis 1996).
Einer der Gründe dafür ist just das Fiatgeld, das durch die (neo-)klassische Denkschule so geflissentlich als neutraler Schleier angesehen wird: Fiatgeld, also weder durch Gold oder sonstige reale Güter unterlegtes Geld, ermöglicht es Haushalten und Unternehmen Kaufkraft auf unbestimmte Zeit zurückzulegen, was bereits allein das Say’sche Gesetz torpediert. Konkret erzeugt die Nachfrage nach Geld als Wertaufbewahrungsmittel in Zeiten ökonomischer Unsicherheit (dies ist die Keynes’sche „Liquiditätspräferenz“) einen Ausfall effektiver, realer Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, denn Fiatgeld ist eben kein Produkt das durch Arbeiter*innen auf Äckern und Feldern kultiviert oder aus Bergwerken abgebaut werden kann; es wird durch einen Federstrich von Geschäfts- und Zentralbanken geschaffen oder vernichtet. Wie Keynes (1936) es selbst ausgedrückt hat:
“Geld in seinen wesentlichen Eigenschaften ist vor allem ein geschicktes Mittel, um die Gegenwart mit der Zukunft zu verbinden; und wir können gar nicht anders als die Effekte sich ändernder Erwartungen auf gegenwärtige Entscheidungen in monetären Größen auszudrücken.“ (Kap. 21, I)
Das aber untergräbt das Konzept der NAIRU, auf dem die gesamte neukeynesianische Inflationstheorie beruht (s.o.): Wenn es kein langfristiges makroökonomisches Gleichgewicht gibt, und demzufolge auch keinen stabilen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation, dann ergibt es keinen Sinn die Arbeitslosigkeit auf einem bestimmten Niveau zu halten, um sicherzustellen, dass keine Inflationsdynamik einsetzt (z.B. Galbraith 1997).
Nominallöhne und -gehälter werden darüber hinaus nicht durch das Wertgrenzprodukt der Arbeit bestimmt, wie das die Vorstellung der (neo-)klassischen Denkschule ist; stattdessen folgt ihre Höhe aus der relativen ökonomischen Macht, wie sie zwischen (unausgesprochen) organisierten Arbeitgebern einerseits und Gewerkschaften andererseits (mit oder ohne Unterstützung durch staatlich verfügte Mindestlöhne) verteilt ist. Im Besonderen sind die Nominallöhne nicht das Ergebnis des Feilschens auf einem ‚Arbeitsmarkt‘ (der aus der Sicht der Post-Keynesianischen Denkschule ohnehin mehr theoretisches Konstrukt als real-existierender Markt ist): Die Löhne und Gehälter werden vielmehr ex post und auf der Grundlage der oben erwähnten relativen Machtverteilung einerseits und dem Bestreben der Unternehmen, ihre wertvollsten Mitarbeiter*innen an sich zu binden andererseits (dies ist die „Effizienzlohntheorie“ Joseph Stiglitz‘ (1974)) ausgehandelt, also nachdem die Unternehmen ihre Produktionspläne auf der Grundlage ihrer erwarteten Absatzchancen festgelegt haben. Mit anderen Worten, die Unternehmen legen ihre Arbeitsnachfrage auf der Basis ihrer Absatzerwartungen und/oder beabsichtigten Arbeitsanreize fest, und nehmen sodann Lohnverhandlungen mit Arbeitnehmervertretungen oder hochqualifizierten Individualbeschäftigten auf. Dies allerdings verleiht den Nominallöhnen oder, wie Keynes sie nannte, „Geldlöhnen“ anstelle der Reallöhne die entscheidende Rolle bei der Erwartungsbildung der Haushalte und Unternehmen, und damit auch im Hinblick auf die Inflation, verbunden mit der entscheidenden Einsicht dass diese nicht primär aus einem theoretisch angenommenen ‚Arbeitsmarkt‘ folgen sondern vielmehr aus exogenen Faktoren wirtschaftlicher Macht, die außerhalb des Marktprozesses liegen (vgl. Keynes 1936, Kap. 19).
In diesem Modell der Welt ist Inflation niemals das Ergebnis von ‚zu viel Geld‘ oder ‚zu niedriger Arbeitslosigkeit‘. Denn Geld ist endogener Bestandteil der Volkswirtschaft, das heißt es wird gemäß der Nachfrage der Wirtschaftssubjekte geschaffen (im Rahmen der oben vorgestellten Quantitätstheorie des Geldes bedeutet das: Das Nominalprodukt aus realen Gütern und Dienstleistungen multipliziert mit ihren Preisen bestimmt die Geldmenge, nicht umgekehrt). Inflation folgt dann vor allem aus überraschenden Enttäuschungen der Erwartungen, die sich Haushalte und Unternehme zuvor gebildet haben, und dabei vor allem ihrer Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Nominallöhne. Dies ist vor allem eine Konsequenz des Umstandes, dass die Erwartungsbildung typischerweise eben nicht rational im Sinne der (neo-)klassischen bzw. neukeynesianischen Schule erfolgt: Menschen verarbeiten neue Informationen nicht unmittelbar und mit perfekter Voraussicht, sondern sind sich einer inhärent ungewissen Zukunft, die sich Vorhersagen weitgehend entzieht, vollkommen bewusst. Im Gegensatz zur neukeynesianischen Theorie verflüchtigen sich makroökonomische Schocks dann aber nicht im Laufe der Zeit, indem die Volkswirtschaft wieder in ihr langfristiges Gleichgewicht zurückkehrt (das es, wie bereits diskutiert, ja auch gar nicht gibt): Stattdessen verbleiben die Auswirkungen dieser Schocks in unterschiedlichen Graden im System und stoßen die Nominallöhne sowie die Preise anderer Produktionsfaktoren und damit das allgemeine Preisniveau höher oder niedriger, und dies potentiell in äußerst destabilisierenden, selbst-verschärfenden Spiralbewegungen in Abhängigkeit des jeweiligen Schocks (ein Prozess, der sich „Hysterese“ nennt).
Ein weiterer Analyseansatz der Post-Keynesianischen Theorie greift daher die obige Erkenntnis auf, wonach Löhne und Gehälter eben nicht durch einen imaginären Arbeitsmarkt festgelegt werden, sondern das Ergebnis relativer ökonomischer Macht sind: Dies ist der sogenannte „Ansatz widerstreitender Ansprüche“ (conflicting claims approach). Dieses Konzept beruht auf den Arbeiten Michal Kaleckis sowie weiterer Autoren, die in der Inflation eine Manifestation der konfligierenden Ansprüche von Arbeitnehmer*innen und Unternehmen auf ihr jeweiliges Stück vom Kuchen des Nationaleinkommens sahen, wobei die Summe dieser Ansprüche jedoch regelmäßig die Größe des Kuchens übersteigt. Die Intensität der Inflation folgt dann unmittelbar aus der Intensität dieses Klassenkampfes um Anteile am Nationaleinkommen, und wie weit die Summe der so beanspruchten Anteile das gegebene Einkommen übersteigt (Isaac 1999). Damit weist dieser Ansatz zugleich auch große Parallelen zur Perspektive politökonomischer Ansätze auf, wie sie weiter unten erörtert werden.
Schließlich existiert noch das sogenannte “Lohnkosten-Aufschlagsmodell“ (wage-cost markup approach), das auf Sidney Weintraub (1978) zurückgeht. Dieses Modell hebt das Verhältnis des Lohnanstiegs zur Produktivitätsentwicklung als maßgebliche Determinante der Inflation hervor. Recht ungewöhnlich innerhalb der Post-Keynesianischen Tradition (und deutlich näher am neukeynesianischen Mainstream) empfiehlt dieser Ansatz gesamtwirtschaftliche Nachfragesteuerung und/oder eine ausreichende „Beschäftigungsreserve“, um das Lohnwachstum in Zaum zu halten und insbesondere zu verhindern, dass dieses den Produktivitätsgewinnen davon läuft. Das heißt Lohninflation und damit allgemeine Inflation sollten am besten durch eine restriktive Steuerung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in Schach gehalten werden – ggf. auf Kosten einer erhöhten Arbeitslosigkeit, geringeren Wachstums in entwickelten Volkswirtschaften sowie niedrigerer Wachstumspfade in Entwicklungs- und Schwellenländern (Atesoglu 1999).
Modern Monetary Theory (MMT)
Der Ansatz der sog. Modern Monetary Theory (MMT) ähnelt in großen Teilen dem der Post-Keynesianischen Theorie, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied dass die MMT der Erwartungsbildung als Einflussfaktor für die Inflation keinerlei Bedeutung beimisst. Aus ihrer Sicht entscheidend sind vielmehr Energiepreise, Marktmacht, Wechselkurse sowie die Veränderung der Löhne und der Verteilung, also dem Ringen von Unternehmen bzw. Kapitaleigentümer*innen und Arbeitnehmer*innen um ein möglichst großes Stück vom Einkommenskuchen. In dieser Hinsicht ähnelt die MMT sogar der Marx’schen Politischen Ökonomie (s.u.; zur MMT im Allg. vgl. Mitchell 2021, Ehnts 2014).
Aus der Perspektive der MMT kann Geld nicht die treibende Kraft hinter der Inflation sein, denn auch in dieser Denkschule ist Geld endogen und kann also nicht über die Liquiditätsnachfrage hinaus (gleich aus welchen Motiven sich diese speist) in die Volkswirtschaft hinein gedrückt werden. Die Geldversorgung folgt der Geldnachfrage, sowohl seitens der öffentlichen Hand als auch der privaten Geschäftsbanken. Konsequenterweise erachtet die MMT daher ganz so wie die Post-Keynesianische Theorie auch Inflation/Deflation als ein realwirtschaftliches Phänomen: Ein Anstieg/Abfall des allgemeinen Preisniveaus ist stets das Ergebnis von ins Ungleichgewicht geratenen Märkten für Güter und Dienstleistungen und niemals von ‚zu viel Geld‘.
In diesem Zusammenhang sieht die MMT die Fiskalpolitik als wichtigsten Treiber ebenso wie wirksamstes Instrument zur Steuerung der Inflation: Wenn der Staat kraft seiner Fähigkeit, gesetzliche Zahlungsmittel in Verkehr zu bringen damit die effektive, reale Nachfrage über das verfügbare reale Angebot an Gütern und Dienstleistungen hinaus treibt, steigen die Preise entsprechend. Damit rückt die Fiskal- und nicht die Geldpolitik in das Zentrum des Interesses, allerdings in einer ex ante-Betrachtung (Wray 2015, Kelton 2022): Wenn und soweit private Marktteilnehmer*innen Inflationsdruck zu erzeugen scheinen (primär durch ein wie auch immer bedingtes, überschäumendes Lohnwachstum), dann sollten die Steuern steigen und ggf. staatliche Ausgaben sinken, um diesen Inflationsdruck von Beginn an einzudämmen. Sollte die Volkswirtschaft dagegen auf Grund massenweiser Kreditausfälle in eine Deflationsspirale zu stürzen drohen, müssen Steuern gesenkt und staatliche Ausgaben ausgeweitet werden, usw. (Man bedenke dabei, dass im Modell der MMT die Staatsausgaben vor den Steuereinnahmen erfolgen, Steuern also nicht die Ausgaben finanzieren! Finanziert werden die Staatsausgaben durch die Ausgabe neuen Geldes, das durch die Vereinnahmung von Steuern dann wieder eingezogen wird.) Wichtig ist hier die ex ante-Operationalisierung: Es nützt nichts bzw. kann sogar schädlich prozyklisch wirken, wenn die Regierung die Steuern anhebt bzw. reduziert, nachdem Inflation bzw. Deflation sich erst mal etabliert haben: Da die Effekte von Fiskalpolitik sich überwiegend erst nach Monaten in der Volkswirtschaft zu verzweigen beginnen, kann keine steuerpolitische Maßnahme ad hoc Effekte erzielen, so dass sie dann meist einen bereits vorhanden Trend noch verstärkt, wenn sie erst mit einiger Verzögerung zum Tragen kommt.
Im Kern teilt die MMT also, wie bereits erwähnt, den Post-Keynesianischen Ansatz der „conflicting claims“ zwischen Arbeit und Kapital (s.o.; Höfgen 2020). Beide Wertschöpfungsträger streben nach einem größtmöglichen Anteil an der gesamten Produktion, doch dieser Wettstreit ist erheblich stärker durch politische als ökonomische Macht gekennzeichnet: Abseits von statistischen Artefakten wie dem Grenzwertprodukt der Arbeit/des Kapitals werden beide Seiten regelmäßig mehr als ihren ‚adäquaten‘ Anteil erstreiten können, während die jeweils andere versuchen wird mindestens ebenso viel zu erlangen; im Ergebnis übersteigt die Summe der Anteile das totale Nominalprodukt vor Verteilungsbeginn, womit die Preise zum Ausgleich steigen müssen.
Perspektiven der Politischen Ökonomie
Innerhalb der Politischen Ökonomie gibt es ebenso diverse „Schulen“ oder „Denkrichtungen“ von denen im Folgenden lediglich eine kleine Auswahl näher vorgestellt wird. Es gibt daher nicht den einen politökonomischen Ansatz zur Erklärung der Inflation oder die eine Inflationstheorie, sondern eine Vielzahl an Positionen, die auch teils gegensätzliche Standpunkte zur Inflation vertreten oder Inflation als Phänomen auf unterschiedlichen Analyse-Ebenen betrachten.
Moderne/Neue Politische Ökonomie
Aus der Perspektive der Modernen/Neuen Politischen Ökonomie bekleidet der Staat die zentrale Rolle eines „egoistischen Rentenmaximierer“ (Kirshner 2001, S. 44), der den Verteilungskonflikt innerhalb seiner Einflussgrenzen durch die Inflation als ein Instrument zu mäßigen sucht, und der Regierung dabei zugleich „hilft [...] ihr Vermögen zu vergrößern und damit ihre Fähigkeit im Amt zu bleiben“ (ebd.). Aus dieser Perspektive, die sich klar aus dem neoklassisch/neukeynesianischen Konsens speist (s.o.), oder auch Elemente des Public-Choice-Ansatzes verarbeitet, werden Institutionen, die der Entpolitisierung der Geldpolitik dienen, als nutzbringend angesehen. Nachdem formell unabhängige Zentralbanken stets seit der Finanzkrise 2008 in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt sind, können einige ihrer seitdem ergriffenen Maßnahmen (darunter vor allem die sog. Quantitative Lockerung, also der Ankauf von Staatsanleihen mittels neu geschöpften Zentralbankgeldes) als monetäre Staatsfinanzierung angesehen werden. So wurde z.B. die Hälfte aller durch das Vereinigte Königreich emittierten Staatsanleihen in diesem Zeitraum durch die Bank von England (BoE) aufgekauft (im krassen Kontrast zur Zeit vor der Finanzkrise, in der die BoE nahezu keine Staatsanleihen in ihren Büchern hielt), während in der Eurozone der Anteil der durch die EZB aufgekauften Staatsanleihen sogar Richtung 70% tendierte (Wullweber 2021).
Marxistische Politische Ökonomie
Marxistisch inspirierte politökonomische Perspektiven dagegen fokussieren auf strukturelle Treiber der Inflation und gelangen zu Recht unterschiedlichen Erklärungen des Phänomens.
Hung und Thompson (2016) beispielsweise greifen ebenfalls den schon im Zusammenhang mit der Post-Keynesianischen Theorie diskutierten Ansatz auf, wonach Preisauf-/abtrieb über die Nominallöhne eher das indirekte Ergebnis relativer politischer Machtverteilung zwischen Arbeit und Kapital sind und damit also durch außerhalb des Marktes liegende Faktoren gesteuert werden. Eine neoliberale Repression und die damit verbundene Entmachtung des Produktionsfaktors Arbeit hielt demnach die Inflation niedrig, während damit einhergehend seit den 1980er Jahren Ungleichheiten bei Einkommen und Vermögen immer mehr zugenommen und zugleich ökonomische Unwuchten einen außer Kontrolle geratenen Finanzboom gespeist haben, der sich schließlich in der Finanzkrise entladen hat. Demgemäß sehen sie im Rückgewinn struktureller Macht auf Seiten des Produktionsfaktors Arbeit ein probates Mittel gegen diese zunehmende Ungleichheit einerseits und der damit verbundenen deflationären Tendenzen andererseits, der sich seit knapp vier Jahrzehnte aufgebaut hat.
Eine weitere Perspektive in der marxistischen Tradition postuliert im Sinne des bereits im Zusammenhang mit der Post-Keynesianischen Theorie bzw. der MMT diskutierten „conflicting claims“-Ansatzes, dass Inflation im Wesentlichen das Ergebnis eines Wettstreits um Einkommensanteile ist. Solch ein Wettstreit wird für den Fall als plausibel angenommen, in dem es ein relatives Machtgefälle mit Blick auf den Zugriff auf den insgesamt erzeugten Mehrwert gibt:
„Inflation stört die gesamte Konvention der Glaubwürdigkeit, die gesellschaftlich um das allgemeine Äquivalent herum geschaffen wurde [... und] tritt auf, wenn die relevanten oder organisierten (Großunternehmen) Akteure mit unterschiedlichem Grad an wirtschaftlicher Macht versuchen, sich einen größeren Teil des gesellschaftlich geschaffenen Mehrwerts anzueignen[: ...] es ist die Wahrnehmung der Macht über den Markt, die das Großunternehmen dazu bringt, seine Preise zu erhöhen“ (Sawaya 2013).
Wenn also Großunternehmen und Konzerne im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise nach maximalen Profiten streben, werden sie nach den höchstmöglichen Preisen trachten. Die Nutzung ihrer Preissetzungsmacht wird dann als Mechanismus zur Steigerung ihrer Profitabilität angesehen, der zu Lasten der Nachfrageseite geht. Inflation ist demnach nicht (nur) durch die schleichende Entwertung des Geldes und dem damit einhergehenden Kaufkraftverlust bedingt, sondern vor allem eine Frage von mehr oder weniger stark ausgeprägter Markt- und damit Preissetzungsmacht und somit der Verteilung des Sozialprodukts.
Entlang den Gedankenlinien von Karl Marx in den ersten Kapiteln seines Magnum Opus „Das Kapital“ verbindet Hardcastle (1974) die Inflation mit dem Kriterium der freien Konvertierbarkeit des Geldes. Steigende Preise folgen demnach aus „einer Über-Emission von inkonvertierbarem Papiergeld”, also einer Entwertung der Währung: „wenn ein allgemeiner Preisanstieg nicht durch eine Währungsabwertung verursacht worden wäre, gäbe es auch keine 'Kosten'- und 'Nachfragesymptome'; was nicht bedeutet, dass individuelle und allgemeine Preissteigerungen nicht auch aus anderen Gründen als der Inflation auftreten können“. Folglich sind Ansätze wie die 'cost-' bzw. 'wage-push'- ebenso wie die 'demand-pull' Inflation kritikwürdig, da sie nach der Meinung Hardcastles darauf hinauslaufen „[die Inflation] anhand ihrer Symptome zu erklären, nicht anhand ihrer Ursache“. Inflation wird demgegenüber vielmehr durch Jene erzeugt, die die Notenpresse kontrollieren. Interessanterweise entspricht diese Inflationsbegründung beinahe gänzlich derjenigen der (neo-)klassischen Denkschule und darin speziell der Quantitätstheorie des Geldes (s.o.), was kein Zufall ist: Karl Marx akzeptierte Vieles an der theoretischen Vorarbeit des klassischen Ökonomen David Ricardo und baute darauf auf.
Französische Régulationstheorie
Analysen der französischen Régulationsschule bauen auf der marxistischen Denkschule auf und entwickeln diese weiter bzw. passen diese an die historisch-bedingten Veränderungen der Rahmenbedingungen an. Ein Vertreter der Régulationstheorie argumentiert deshalb, dass es im Rahmen des Marx’schen Konstrukts der „Wertform“ während des ökonomischen Tauschs zur Transformation der Substanz (dazu zählt v.a. abstrakte Arbeit) kommt, eben von ihrer Wertform in die sog. Geldform; eine Verwandlung, die für die Marx’sche Theorie von größter Bedeutung ist:
„Die gesellschaftliche Produktion ist als Summe von Aktivitäten ‚privater‘ Einheiten organisiert, die unabhängig voneinander arbeiten. Die Vergesellschaftung der privaten Arbeit erfolgt in Form eines Austauschs von Produkten, der zwei Aspekte in sich birgt: (1) die Übertragung von Gebrauchswerten zwischen den Eigentümern nach relativen Werten, die vielleicht durch andere soziale Beziehungen ‚transformiert‘ werden, wie den Ausgleich von Gewinnen, die Bildung von Mieten usw. [Lipietz, 1979b; 1982]; und (2) die Bestätigung der gesellschaftlichen Geltung jeder privaten Arbeitseinheit auf diese Weise.“ (Lipietz 1982, S. 50, eigene Hervorhebungen)
Geld dient also als ein allgemeines Äquivalent (wiederum ein Konzept aus der klassischen Ökonomik; man denke an den Begriff „Numéraire“ für die Zählfunktion des Geldes als eine der drei Hauptfunktionen in den meisten Geldtheorien), solange „universelle Arbeit, die überall innerhalb der gesellschaftlichen Arbeitsteilung geleistet wird” über einen Tauschwert insofern verfügt als diese abstrakte/universelle Arbeit eine gewisse Kaufkraft repräsentiert (Lipietz 1982, S. 51). Der Erhalt dieser Kaufkraft hat sich seit der Generalisierung des Kredit- bzw. Fiatgeldes nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems in den 1970er Jahren tiefgreifend verändert (hier kommt erneut eine Verbindung zwischen der Marx’schen und der Post-Keynesianischen Theorie zum Vorschein: Die Vorstellung von Kaufkraft, die der ökonomischen Zirkulation durch das Horten von Fiatgeld entzogen werden kann, ist der Grund warum das Say’sche Gesetz vom Angebot, das sich seine eigene Nachfrage schafft, verletzt wird, s.o.).
So wurde demzufolge ein „Anpassungsproblem” identifiziert, das der kapitalistischen Produktionsweise innewohne. Im Fall eines Warengeldes, wo das Geld in Gestalt eines Metalls oder einer anderen physischen Ware mit innerem ökonomischen Wert auftritt, wird diese Anpassung als gegeben angenommen: Gold als das exemplarische, physisch knappe Warengeld wirkt dann als Begrenzung für die Versuche der „Kapitalisten“ immer höhere Preise zu verlangen. Im Fall des Kreditgeldes jedoch geschieht die Anpassung global:
„Die Auswirkung der intertemporalen Beziehungen auf das System der nominalen Preise macht sich auf zweierlei Weise bemerkbar. Im Falle des Warengeldes besitzt eine Unze Gold immer den gleichen Preis. Die Preise werden daher sinken, damit sie sich wieder an die internen Verhältnisse anpassen. Beim Kreditgeld hingegen ist das Geldeinkommen der beiden sozialen Klassen nominal definiert - so viel pro Monat für die Arbeiter und eine bestimmte jährliche Kapitalrendite. Daraus folgt, dass die Preise mit einer Inflationsrate steigen werden, die der Differenz zwischen der realen Profitrate und der nominalen Rate entspricht.“ (Lipietz 1982, S. 55)
Mit der Ausreichung von Kreditgeld korrespondierend zur Nachfrage nach Produktivkapital wird Geld somit endogener Bestandteil des ökonomischen Systems, der lediglich durch die Erwartungen der Banken hinsichtlich der Geschäftschancen (und somit Zahlungsfähigkeit) ihrer Kunden begrenzt wird (Lipietz 1982). Kreditgeld wird also ex ante durch die privaten Geschäftsbanken validiert und schließlich zum Nennwert durch die Zentralbanken lediglich pseudo-validiert, deren Aufgabe in der Bewahrung einer ausreichenden Liquidität in systemkritischen Märkten und zugleich der Inflationskontrolle besteht.
Kritische Politische Ökonomie
Eine wichtige Einsicht der Kritischen Politischen Ökonomie besteht darin, dass es eine beständige, strukturelle Lücke zwischen der aggregierten Kaufkraft (in den Worten von Keynes ausgedrückt: der effektiven Nachfrage) auf der einen Seite und den auf dem Markt verfügbaren Preisen von Gütern und Dienstleistungen auf der anderen Seite geben könnte (Douglas 1931). Da die Unternehmen ihre Preise in Abhängigkeit der Summe der Kosten ihrer Inputfaktoren (Boden, Arbeit, Kapital) bestimmen sowie in Abhängigkeit von der Wettbewerbsintensität in ihrem jeweiligen Markt, weben sie darauf aufbauend einen Aufschlag („markup“) zur Entlohnung ihres unternehmerischen Risikos ein und versuchen insgesamt als Preis zu verlangen, „was der Markt hergibt“ (Veblen 1923, S. 85). Und weil die meisten Unternehmen diesem Preissetzungsmechanismus verfolgen, wird die aus dem Aufschlag resultierende Lücke mindestens teilweise über die Schöpfung neuen Kreditgeldes geschlossen (Di Muzio u. Noble 2017). Der moderne Kapitalismus gründet somit auf dem strukturellen Erfordernis von Kredit und Schulden, die das Zahlungsmittel zur Begründung einer neuen Investition ex ante zur Verfügung stellen, und deren Zinsen zugleich für die Kostenaufschlagskalkulation der Preise verantwortlich ist (ebd.). Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ergibt sich daraus, dass „es immer mehr Schulden im System gibt als die Fähigkeit, die Schulden zurückzuzahlen“, da während der Geldschöpfung durch die Gewährung eines Kredits die Banken stets „die Tilgungszahlung (bzw. den Kapitalbetrag), niemals den Zins“ kreieren (ebd., S. 101). Die Zinsen des Kreditgeldes jedoch werden aus der Perspektive der Kritischen Politischen Ökonomie als wesentlicher Treiber sog. differentieller Inflation angesehen (es gibt eine natürliche Varianz zwischen Unternehmen in Bezug auf ihren Verschuldungsgrad, ihre Produktionskosten, ihre Profitmarge und damit die Zinssätze, die sie zu tragen haben), da die Zinskosten an die Verbraucher weitergegeben werden (ebd., S. 103f.). Unter der Annahme, dass die meisten Unternehmen sich nicht ausschließlich aus einbehaltenen Gewinnen finanzieren, wachsen die Unternehmensschulden somit proportional mit den Zinslasten, die zugleich ein wesentlicher Faktor des Preisauftriebs sind.
Aus der kritischen politökonomischen Perspektive treten periodische Krisen der Überproduktion/Unterkonsumption auf, weil die „immer länger werdende Zahlungsketten“ in Verbindung mit den zur Schuldentilgung in jeder Periode verfügbaren Mitteln – wie oben diskutiert – ab einem bestimmten Punkt überdehnt sind. Dies ist meist auch der Zeitpunkt, zu dem die Zentralbank in ihrer Funktion als Kreditgeber und Marktpartei ‚der letzten Instanz‘ auf den Plan tritt. Die Wachstumsphasen, die solchen Krisen vorgelagert sind, werden dann verstanden als systembedingt uneinheitliche Entwicklungspfade, die Vorteile kapitalintensiver Investitionen in der funktionellen Einkommensverteilung bergen; der Grund dafür liegt in der strukturellen Dominanz des Kapitals vis-à-vis abhängiger Lohnarbeit ebenso wie im Privileg der Kreditgeldschöpfung mit der Schaffung der Tilgungsbeträge, nicht aber der damit verbundenen Zinslasten (s.o.). Marxistisch geprägte Forschungsarbeiten weisen hier auf die disparaten Auswirkungen von Inflation auf verschiedene Einkommensklassen hin: Weniger einkommensstarke Haushalte sind von steigenden Preisen vergleichsweise stärker betroffen, weil sie diese (ausschließlich) aus einem relativ fixen Monatseinkommen bestreiten müssen, während die einkommensstärkeren und zumal vermögenden Haushalte auf Ersparnisse in Immobilien, Aktien oder Anleihen zurückgreifen können (die allerdings durch die Inflation teils auch empfindliche Wertverluste erfahren). Was dieses Wohlstandsgefälle jedoch noch verstärkt oder zumindest verfestigt, ist der Umstand, dass die weniger wohlhabenden Haushalte, Unternehmen oder Regierungen entweder keinen Zugang zu Krediten oder höhere Kreditkosten tragen müssen aufgrund der höheren zu zahlenden Zinsen, die zusätzlich zu den allgemein in der Wirtschaft anfallenden Zinsen zu tragen sind, als deren kreditwürdigeren Pendants, die bessere Zinssätze erhalten und auch ein viel größeres Kreditvolumen aufnehmen können (Piketty 2014).
Soziologische Theorie
Soziologische Erklärungsansätze zur Inflation teilen vielfach ihre analytischen Grundannahmen mit politökonomischen Autoren (s.o.), darunter v.a. die Kritik an orthodoxer ökonomischer Konzeptualisierung (z.B. der „Ökonomismus“ der neoklassischen Denkschule, wie es Bourdieu (1990) ausgedrückt hat) aber auch die Betonung der politischen und sozialen und damit inhärent konfliktbeladenen Einbettung von ökonomischen Phänomenen (vlg. z.B. Ingham 2004, S. 80-81).
Goldthorpe (1978) bietet einen guten Ausgangspunkt, indem er beispielhaft aufzeigt inwiefern eine soziologische Betrachtung der Inflation beide der genannten Forschungsziele aufgreifen kann. Er wendet gewissermaßen eine immanente Kritik ökonomischer Erklärungsansätze an, indem er „residuale Kategorien” identifiziert, also kausale Faktoren innerhalb einer bestimmten Theorie, die zu Erklärung eines bestimmten empirischen Phänomens herangezogen werden, deren Ausbildung/Emergenz selbst jedoch abhängig ist von Faktoren, die außerhalb der Analyse liegen.
So führen z.B. Monetaristen die Inflation auf einen (übermäßigen) Anstieg der Geldmenge zurück, deren Festlegung wiederum ein Herrschaftsrecht des Staates ist. Warum allerdings Politiker und Zentralbanker überhaupt eine Ausdehnung der Geldmenge anstreben kann nicht in endogener Weise erklärt werden; Goldthorpe (1978, S. 187-89) stellt fest, dass dieses Problem dann entweder durch den Rückfall auf normative Argumente gelöst wird (also z.B. anhand von sich vermeintlich ‚irrational‘ verhaltenden Regierungen, die einer ‚schlechten‘ ökonomischen Theorie anhingen) oder aber durch die Ausdehnung der ökonomischen Analysemethode auf Gegenstände, die für gewöhnlich außerhalb ihres Anwendungsbereichs liegen:
"Das Problem von Regierungshandeln in Bezug auf Inflation wird durch marktbezogene Begriffe beschrieben – d.h. im Rahmen eines ‚Politik-Marktes‘ – und eine Lösung wird folglich mittels Analyse von Einflussfaktoren auf diesem Politik-Markt gesucht.“ (Goldthorpe 1978, S. 188)
Ein vergleichbares Problem entsteht im Zusammenhang mit einer weiteren Inflationstheorie, die auf „cost-push“-Überlegungen beruht. Hier sind es nicht Regierungen sondern Gewerkschaften, die durch ihre wiederkehrenden und sprunghaften Forderungen nach höheren Löhnen als die zentralen Agenten hinter einem Anstieg des Preisniveaus verantwortlich gemacht werden (Goldthorpe 1978, S. 189). Der Ursprung dieser ‚exzessiven’ Lohnforderungen wird wiederum in vermeintlich irrationalem Verhalten verortet, das die ökonomische Standardtheorie kaum oder sogar gar nicht erklären kann: Zeitgenössische Autor*innen dieser Sichtweise vertreten wahlweise Konzepte wie „Gewerkschaftsrivalität", „Neid" oder „Ideologie" (Goldthorpe 1978, S. 191-2), die Gewerkschaftsführer dazu anstiften, die unweigerlichen Konsequenzen ihres Handelns (nämlich ein immer stärker steigendes Preisniveau) zu ignorieren.
Goldthorpe (1978) regt stattdessen an, dem Phänomen der Inflation von einer soziologischen Warte aus auf den Grund zu gehen, d.h. a) Inflation mit „anhaltenden Veränderungen von sozialen Strukturen und -Prozessen“ (Goldthorpe 1978, S. 195) zu verbinden statt sich ausschließlich auf Interaktionen in der ökonomischen Sphäre zu konzentrieren, und b) mit analytischen Kategorien zu arbeiten, die es erlauben, das vermeintlich irrationale Verhalten von Gewerkschaften u.ä. als soziologisch nachvollziehbar zu erschließen. Goldthorpe betont dabei drei miteinander verschränkte Kausalfaktoren, die historisch zu „einer Verschärfung des sozialen Konflitks" (Goldthorpe 1978, S. 196) in kapitalistisch strukturierten Gesellschaften geführt hätten: Erstens die abgeschwächte Rolle des sozialen Status‘ als moralische Legitimation für Klassenunterschiede, in dem Sinne, dass kulturelle Privilegien (etwa aristokratische Vererbungslinien) nicht länger voneinander verschiedene sozio-ökonomische Lebensbedingungen rechtfertigen. In der Folge jedoch wird sozialer Konflikt wahrscheinlicher, „denn sobald eine normative Ordnung des sozialen Status beseitigt wird, gibt es keinen offensichtlichen Grund warum die Einkommensansprüche verschiedener Gruppen von Lohnarbeiter*innen nicht ausgedehnt werden sollten“ (Goldthorpe 1978, S. 200). Zweitens tendiert die umfassende Einführung der Staatsbürgerschaft (Marshall) als „die prinzipielle Gleichheit bürgerlicher Rechte" (Goldthorpe 1978, S. 202) unter den Mitgliedern derselben nationalen Gemeinschaft zu einer Akzentuierung von Ungleichheit, die durch Marktprozesse und Regierungshandeln bedingt werden, sofern diese (erhöhte) Arbeitslosigkeit erzeugen – und damit potentiell eine „entschlossene Reaktion" (Goldthorpe 1978, S. 204) seitens der Arbeiter*innen und der Gewerkschaften provozieren. Schließlich drittens die Entstehung einer in Goldthorpes Worten ‘reifen’ Arbeiterklasse für die „die Organisation in Gewerkschaften die gewöhnliche Vorgehensweise darstellt, durch die die Arbeitsbedingungen und Lebensstandards verteidigt und soweit wie möglich verbessert werden“ (Goldthorpe 1978, S. 207).
Indem Goldthorpe diese eher generellen Erklärungsversuche für das Verhalten ökonomischer und sozialer Akteure vorbringt, das orthodoxe ökonomische Theorien nicht berücksichtigen, vernachlässigt er doch klar voneinander verschiedene institutionelle Setups (z.B. kollektive Lohnverhandlungen in korporatistisch geprägten Systemen wie Deutschland) in zeitgenössischen kapitalistischen Gesellschaften. Überdies schrieb Goldthorpe zu Zeiten einer ausgeprägten Stagflation im Gefolge historischer Ölkrisen; folglich ist es nicht gesichert, ob und wie weit seine Schlussfolgerungen auch für andere empirische Anwendungsfälle wie z.B. die beständige Deflation im Rahmen des ‚verlorenen Jahrzehnts‘ für Japan oder globalere Trends wie die beständige Abnahme der Mitgliederzahlen von Gewerkschaften und damit deren Verhandlungsmacht in industrialisierten Volkswirtschaften valide sind.
In jüngerer Vergangenheit wurden von Forscher*innen aus dem Umfeld der institutionalistischen Theorie Ansätze verfolgt, die als Versuch zur Beantwortung der bezeichneten Lücken in Goldthorpes Theorie angesehen werden können, so z.B. Hall und Franzese Jr. (1998). Indem sie einen Ansatz der vergleichenden politischen Ökonomie wählen (CPE), analysieren sie die Interaktionen zwischen Zentralbanken und heimischen kollektiven Lohnverhandlungsstrukturen und deren jeweiligen makroökonomischen Effekte; dabei konzeptualisieren sie letztere als „den Grad zu dem Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände aktiv die Festsetzung von Tarifverträgen für das ganze Land koordinieren“ (Hall and Franzese Jr. 1998, S. 509). Ihre quantitative, internationale (mit Fokus auf die OECD) Untersuchung setzt einen Kontrapunkt gegen die aktuell vorherrschende, neoklassisch-monetaristische Begründung für unabhängige Zentralbanken, indem sie den Signalling-Mechanismus zwischen den Zentralbanken und den institutionellen Akteuren innerhalb der kollektiven Lohnverhandlungsstrukturen betonen, wobei sie für diesen Mechanismus eine besondere Wirksamkeit für korporatistisch strukturierte Gesellschaften finden (Hall and Franzese Jr. 1998, S. 524). Da neu zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden vereinbarte Lohnabschlüsse in einem solchen Setup die heimische Wirtschaft stärker zu beeinflussen neigen als in relativ dezentralisierten, unkoordinierten Strukturen, dürfte „die Zentralbank sehr wahrscheinlich direkt darauf reagieren“ (Hall and Franzese Jr. 1998, S. 511). Dies wiederum sensibilisiert Institutionen noch zusätzlich für Signale der Zentralbank hinsichtlich ihrer zukünftigen Geldpolitik, die so „Einfluss auf das Niveau der Lohnabschlüsse nehmen und damit die Inflation reduzieren könnten […]" (Hall and Franzese Jr. 1998, S. 511). Mit anderen Worten, eine niedrige Inflation liegt nicht nur in der Unabhängigkeit von Zentralbanken begründet, sondern auch „im Charakter einer Reihe von gesellschaftlichen Institutionen […], die aus einem langen historischen Prozess hervorgegangen sind und gegenüber politischer Einflussnahme weitgehend immun sein dürften“ (Hall and Franzese Jr. 1998, S. 525) – ein Ergebnis, das durchaus konsistent ist mit den Schlussfolgerungen Goldthorpes.
Auf einer mehr systemischen, geschichtsorientierten Ebene hat etwa Streeck (2011, 2014) wiederholt die Rolle der Inflation als (politisches) Instrument „um potentiell destabilisierende soziale Konflikte zu entschärfen“ (Streeck 2014, S. xiv) beschrieben, insbesondere in der für den Kapitalismus der Nachkriegszeiten kritischen ersten Hälfte der 1970er Jahre. In einer Situation, die ohnehin bereits durch großangelegte Streiks (1968 und in den Jahren darauf) stark angespannt war, sahen sich Regierungen „mit der Frage konfrontiert, wie man Gewerkschaften zur Abmilderung der Lohnforderungen ihrer Mitglieder bewegen könnte ohne zugleich das keynesianische Versprechen der Vollbeschäftigung zurücknehmen zu müssen" (Streeck 2011, S. 11). Während korporatistische Gesellschaften in dieser Situation auf einen Drei-Parteien-Sozialdialog zurückgreifen konnten um Lohnzurückhaltung zu erreichen, griffen Gesellschaften mit vergleichsweise restriktiven institutionellen Setups zu einer expansiven Geldpolitik als „einer bequemen Ersatzmethode um einen sozialen Nullsummen-Konflikt“ (Streeck 2011, S. 12, original emphasis) zwischen Arbeit und Kapital zu vermeiden. Damit akzeptierten politische Akteure absichtsvoll zumindest vorübergehend höhere Inflationsraten, „während sie den gleichzeitigen Bestand von kollektiven Lohnverhandlungen und Vollbeschäftigung nebeneinander fortzubestehen erlaubten“ (Streeck 2011, S. 11). Sowie dieser Anstieg der Inflation sich allerdings beschleunigte, traten die enormen Verteilungseffekte hinsichtlich verschiedener sozialer Gruppen mehr und mehr zum Vorschein (vgl. Krippner 2011, S. 17f. für die USA), und politische Entscheidungsträger*innen mussten ihre Strategie überdenken – eine Kehrtwende, die in den ‚Volcker-Schock‘ von 1979 mündete.
Was solche soziologisch motivierten Perspektiven auf das Phänomen der Inflation insgesamt aufzeigen ist, dass Preisauftrieb in keiner Weise eine rein technische, neutrale Statistik ist, die monokausal aus der Steuerung der Geldmenge resultiert; stattdessen existieren vielmehr vielfache, konfligierende Interessen verschiedener Akteure, die diesem Phänomen zu Grunde liegen und seine Komplexität noch verstärken, deren Durchdringung mit Standardmethoden der Ökonomik allein kaum leistbar sein dürfte.
Es gibt noch so viel zu entdecken! 🚀
Im Entdecken-Bereich haben wir hunderte Videos, Texte und Podcasts zu ökonomischen Themen gesammelt. Außerdem kannst du selber Material vorschlagen!
Material entdecken Material vorschlagen
References
Anderegg, R. (2007): Grundzüge der Geldtheorie und Geldpolitik. München: Oldenbourg Verlag.
Arestis, P. (1996), ‘Post-Keynesian economics: towards coherence’, in: Cambridge Journal of Economics, Vol. 20(1), pp. 111-135.
Atesoglu, H. S. (1999) 'Inflation: conflicted claims approach' in O'Hara, P. A. Encyclopedia of Political Economy: A-K, pp. 510-512.
Blanchard, O. (1991) ‘Neoclassical Synthesis’. In: Eatwell J., Milgate M., Newman P. (eds) The World of Economics. The New Palgrave. Palgrave Macmillan, London. [online available at: https://economics.mit.edu/files/677]
Bourdieu, P. (1990) The Logic of Practice. Stanford, California: Stanford University Press.
Di Muzio, T. and Noble, L. (2017) 'The Coming Revolution in Political Economy: Money, Mankiw and Misguided Macroeconomics', in Real-World Economics Review, Vol. 80, pp. 85-108.
Douglas, C. H. (1931) The Monopoly of Credit. London: Chapman and Hall.
Ehnts, D. (2014) Geld und Kredit: eine €-päische Perspektive. Marburg: Metropolis Verlag.
Friedman, M. (1970) Counter-Revolution in Monetary Theory. Wincott Memorial Lecture, Institute of Economic Affairs, Occasional paper 33.
Galbraith, J. (1997) ‘Time to Ditch the NAIRU’, in Journal of Economic Perspectives, Vol. 11(1), pp. 93-108.
Goldthorpe, J. (1978) 'The Current Inflation: Towards a Sociological Account' in Hirsch, F. and Goldthorpe, J., The Political Economy of Inflation, Harvard University Press, pp. 186–216.
Hall, P. & Franzese, Jr., R. (1998) 'Mixed Signals: Central Bank Independence, Coordinated Wage Bargaining, and European Monetary Union' in International Organization 52, 3, pp. 505-535.
Hardcastle, E, (1974) Inflation: the theories and the facts, [online available at: <https://www.marxists.org/archive/hardcastle/1974/inflationfacts.htm>, last accessed 06/04/2021].
Höfgen, M. (2020) 'Die Rolle der Inflation in der Modern Monetary Theory' [online available at: <https://mauricehoefgen.com/die-rolle-der-inflation-in-der-modern-monetary-theory-mmt>, last accessed 11/10/2022]
Hung, H. and Thompson, D. (2016) 'Money Supply, Class Power, and Inflation: Monetarism Reassessed', in American Sociological Review, Vol. 81(3), pp. 447-466.
Ingham, G. (2004) The Nature of Money. Cambridge/Malden, MA: Polity Press.
Isaac, A.G. (1999) 'Inflation: conflicted claims approach' in O'Hara, P. A. Encyclopedia of Political Economy: A-K, pp. 508-510.
Kelton, S. (2022) 'Stephanie Kelton on MMT and the Inflation We're Seeing Today' [online available at: <https://open.spotify.com/episode/2Fn7x9TBN1V1GwaDW7obav>, last accessed 11/10/2022], part of the podcast series 'Odd Lots', Bloomberg, 2015-, <https://www.bloomberg.com/oddlots-podcast>
Keynes, J. M. (1936) The General Theory of Employment, Interest, and Money, Palgrave Macmillan.
Kirshner, J. (2001) 'The Political Economy of Low Inflation', in Journal of Economic Surveys, Vol. 15(1), pp. 41-70.
Krippner, G. (2011) Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance. Cambridge, MA/London: Harvard University Press.
Lipietz, A. (1982) 'Credit Money: A Condition Permitting Inflationary Crisis', in Review of Radical Political Economics, Vol. 14(2), pp. 49–57.
Mankiw, N.G. (2019): Macroeconomics. 10th ed., New York City: Worth publishers.
Marx, K. (1887) ‘Capital - A Critical Analysis of Capitalist Production’, in Marx/Engels Gesamtausgabe (MEGA) Abt. 2, Bd. 9, Berlin: Dietz Verlag.
Mitchell, B. (2021): Modern Monetary Theory,
[online available at: <http://bilbo.economicoutlook.net/blog/>, last accessed 09/24/2021]
Piketty, T. (2014) Capital in the Twenty-First Century. London: Belknap Press.
Sawaya, R. R. (2013) Value, price, inflation and the Power of Capital: a Marxist Vision, [online available at: <https://www.hetecon.net/wp-content/uploads/2019/12/Sawaya_AHE2013.pdf>, last accessed 06/04/2021].
Stiglitz, J. (1974) ‘Alternative Theories of Wage Determination and Unemployment in LDC's: The Labor Turnover Model’, in Quarterly Journal of Economics, Vol. 88(2), pp. 194-227.
Streeck, W. (2011) 'The Crises of Democratic Capitalism' in New Left Review 71, pp. 5-29.
Streeck, W. (2014) Buying Time. The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. London/New York: Verso.
Tooze, A. (2021) Chartbook Newsletter #22: How do you count inflation? Tracking Weimar's hyperinflation., [online available at: <https://adamtooze.substack.com/p/chartbook-newsletter-22>, last accessed 07/12/2021].
Veblen, T. (1923) Absentee Ownership: Business Enterprise in Recent Times. New Brunswick: Transaction.
Weintraub, S. (1978) Capitalism's Inflation and Unemployment Crisis: beyond Monetarism and Keynesianism, Addison-Wesley.
Wray, L.R. (2015) Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems, London: Palgrave Macmillan
Wullweber, J. (2021) Zentralbankkapitalismus, Berlin: Suhrkamp.
Dieser Inhalt wird unter einer Creative Commons-Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) zur Verfügung gestellt.