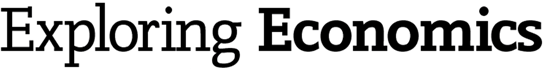Wie Arbeitskritik die Klimadebatte bereichern kann
Economist for Future, 2020
Wie Arbeitskritik die Klimadebatte bereichern kann
Maja Hoffmann
Erstveröffentlichung im Makronom
In der Auseinandersetzung um eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft ist die Arbeitskritik eine unerlässliche Perspektive. Denn Arbeit basiert immer auf Ressourcen- und Energieverbrauch und hat somit immer direkte oder indirekte Umweltauswirkungen. Ein Beitrag von Maja Hoffmann.



![]()
Was folgt aus der Klimakrise für unsere Wirtschaft(sweisen) und das Denken darüber? Im Angesicht der Fridays-for-Future-Proteste hat sich aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik eine neue Initiative herausgebildet: Economists for Future. Mit der gleichnamigen Debattenreihe werden zentrale Fragen einer zukunftsfähigen Wirtschaft in den Fokus gerückt. Im Zentrum stehen nicht nur kritische Auseinandersetzungen mit dem Status Quo der Wirtschaftswissenschaften, sondern auch mögliche Wege und angemessene Antworten auf die dringlichen Herausforderungen und Notwendigkeiten. Dabei werden verschiedene Orientierungspunkte für einen tiefgreifenden Strukturwandel diskutiert.
Für kurze Zeit war im Frühjahr 2020 die unter jüngeren Menschen verbreitete Angst vor dem Klimawandel gelindert: Die Raffinerien standen endlich still, der Energieverbrauch ging zurück, die Emissionen sanken. Schnell nahm die globale, fossil befeuerte Wirtschaft allerdings wieder an Fahrt auf, die Verhältnisse „normalisierten“ sich – und wir sind wieder auf Zerstörungskurs: Die Überschreitung der nur noch sehr knappen verbleibenden CO2-Budgets für maximal 1,5°C bis 2°C globale Erwärmung zusammen mit der fortschreitenden Zerstörung wichtiger Naturräume bedeutet, dass Kipppunkte erreicht und selbstverstärkende Rückkopplungsprozesse im Erdsystem ausgelöst werden. Ein sich weiter beschleunigender Klimawandel wäre dann nicht mehr zu beeinflussen, Emissionsreduktionen würden nichts mehr bewirken. Die Erde würde nach und nach für irdisches Leben, inklusive der Menschen, weitgehend unbewohnbar.
Im Paris-Abkommen haben 195 Nationen zugesagt, dies zu verhindern. Das bedeutet, dass substantielle Emissionsreduktionen in sehr kurzer Zeit nötig sind – viel kürzer als die beliebte, weil letztlich noch fern in der Zukunft liegende Zielmarke von 2050. Für moderne Industriegesellschaften, die nach wie vor zu weit über 90% auf fossilen Energieträgern basieren und die Biosphäre weiterhin in hohem Tempo ausbeuten und zerstören, heißt das: Es ist eine grundlegende sozial-ökologische Transformation ihrer Lebens- und Wirtschaftsweise nötig.
Die Bedeutung der Arbeit
Aber was sind eigentlich „moderne Industriegesellschaften“? Im historischen und kulturellen Vergleich sind sie vor allem eines: auf Arbeit fokussiert und von Arbeit abhängig. Arbeit (primär als Erwerbsarbeit basierend auf produktivistischen Moralvorstellungen) ist eine der zentralen Sozialbeziehungen der modernen Gesellschaft. Diese Gesellschaft und ihre Wirtschaft, ihre Energie- und Ressourcenbasis und ihre Produktions- und Konsumsysteme grundlegend zu verändern, bedeutet tiefgreifende Folgen für Arbeit in allen Bereichen.
Arbeit basiert immer auf Ressourcen- und Energieverbrauch und hat somit immer direkte oder indirekte Umweltauswirkungen
Dass Arbeit tatsächlich diese zentrale Rolle spielt, wird am altbekannten „Arbeitsplatz-Argument“ regelmäßig deutlich: Arbeitsplätze genießen absolute Priorität, sie rechtfertigen Umweltzerstörung und die fortwährende Existenz destruktiver Industrien. Es gibt einen breiten Konsens quer durch alle politischen Lager, dass Arbeitsplätze erhalten und neue Jobs geschaffen werden müssen, ganz egal welche. Die von der deutschen Bundesregierung eingesetzte „Kohlekommission“ ist ein prominentes Beispiel: Die Förderung klimaschädlicher Braunkohle, eigentlich nur noch existent dank massiver staatlicher Subventionen und verantwortlich für die Verwüstung ganzer Landstriche, wird laut ihrem Beschluss noch fast zwei Jahrzehnte fortdauern, um Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze in den betroffenen Regionen nicht zu gefährden.
Dieser Konflikt ist alles andere als leicht aufzulösen und ein wiederkehrendes Thema in der öffentlichen Debatte – in der Wissenschaft allerdings bleibt er merkwürdig unterbelichtet, ebenso wie das Thema Arbeit und Nachhaltigkeit allgemein. Dies gilt auch für die Wirtschaftswissenschaft: Arbeit als solche, d.h. nicht nur abstrakte Kennzahlen über Arbeitszeit, Arbeitskosten, Arbeitsangebot und -nachfrage, Arbeitslosigkeit oder Arbeitsproduktivität, sondern ihre historisch besondere Konzeption und Organisation sowie konkrete Arbeitsinhalte und Tätigkeiten, sind in der Ökonomik kaum ein Thema (mit Ausnahme der feministischen Ökonomik). In diesem Beitrag soll der Fokus auf Arbeit im Rahmen interdisziplinärer Nachhaltigkeitswissenschaft liegen, was die Ökonomik einschließt aber mehr ist als das – bzw. das, was eine Wirtschaftswissenschaft, die es mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aufnehmen kann, weil sie Naturgesetze berücksichtigt und vielfältige Ansätze verfolgt, eigentlich sein sollte.
Das Problem mit Arbeit: Umweltbelastung…
Es mag trivial klingen, wird aber allzu oft vergessen: Grundsätzlich basiert Arbeit immer auf Ressourcen- und Energieverbrauch und hat somit immer direkte oder indirekte Umweltauswirkungen. So zeigen Studien, dass ein eindeutiger und unmittelbarer Zusammenhang zwischen Umweltbelastung und Arbeitszeit besteht, sowohl auf Haushalts- als auch auf Makro-Ebene, und für Industriestaaten wie auch für Länder des globalen Südens. Mindestens vier Faktoren lassen sich als Ursache identifizieren:
All dies sind strukturelle Probleme der Art und Weise wie Arbeit in der industriellen Moderne organisiert ist – die häufig als Lösung betrachteten „grünen Jobs“ ändern an diesen Bedingungen und Auswirkungen, und damit am Kern des Problems, nichts. Zudem sind dies „nur“ ökologische mit Arbeit verbundene Probleme; hinzu kommen vielfältige gesellschaftliche und ökonomische Probleme (auf die hier nicht eingegangen werden kann).
Bleibe auf dem Laufenden!
Abboniere unsere Newsletter, um von neuen Debatten und Theorien, Konferenzen und Schreibwerkstätten zu erfahren.
Exploring Economics Plurale Ökonomik
…und strukturelle Abhängigkeiten
Wenn Arbeit ökologisch erwiesenermaßen problematisch ist, warum gilt das Mantra „Jobs first“ so beständig gegenüber ökologischen Argumenten? Welche Zwänge verhindern Veränderungen?
In modernen „Arbeitsgesellschaften“ gibt es verschiedene strukturelle Abhängigkeiten von Arbeit: Auf individueller Ebene ist Erwerbsarbeit zwingend nötig für die Sicherung des Lebensunterhalts, für soziale Absicherung, Integration und Status, sowie oft auch persönliche Identitätsbildung – Arbeitslosigkeit bedeutet sozialen Ausschluss, Verlust von Anerkennung und existentielle Risiken. Auch unbezahlte Aktivitäten werden auf dieser Grundlage von Anerkennung sowie sozialstaatlicher und gewerkschaftlicher Unterstützung ausgeschlossen.
Für die moderne Industriegesellschaft ist Arbeit sowohl Hauptmittel als auch Hauptzweck
Zweitens funktioniert der moderne Wohlfahrtsstaat primär auf Basis von Arbeit. Die Steuereinnahmen aus Arbeit und aus durch Arbeit generiertem Konsum tragen wesentlich zur Finanzierung sozialer Sicherungssysteme bei. So legitimiert sich Politik auch durch die Schaffung von Jobs – und somit ist es nicht wichtig, um welche Jobs es genau geht. Zudem ist die disziplinierende und strukturierende Rolle von Arbeit für moderne Staaten nicht zu unterschätzen.
Drittens ergibt sich eine gesamtwirtschaftliche Abhängigkeit von Arbeit in modernen Ökonomien daraus, dass unter dem Gebot von Wachstum und Wettbewerb eine fleißige Erwerbsbevölkerung, lange Arbeitszeiten und steigende Produktivität für steigenden Output, steigende Einkommen, steigende Kaufkraft und Nachfrage unabdingbar sind.
Schließlich gibt es eine besondere Abhängigkeit auf kultureller Ebene: Die moderne Arbeitsethik ist nach Max Weber konstitutiv für die industrielle Kultur und ihre Subjekte, spürbar im tiefsitzenden moralischen Zwang zu stetiger Arbeit und Zeitsparen, in der Idealisierung von Produktivität, Leistung und Unternehmertum, im Gefühl von Schuld, wenn Zeit verschwendet wird, oder in der persönlichen Identifikation mit dem Beruf. All das ist so selbstverständlich, dass es äußerst weltfremd wirkt, es in Frage zu stellen.
André Gorz hat es treffend zusammengefasst: Für die moderne Industriegesellschaft ist Arbeit sowohl Hauptmittel als auch Hauptzweck. Aus dieser Konstellation – umweltschädlichen Auswirkungen von Arbeit auf der einen und systemischen Zwängen zur Arbeit auf der anderen Seite – ergibt sich der Konflikt zwischen Arbeit und Umwelt, der ein zentrales Nachhaltigkeitsproblem bleiben wird, so lange er nicht direkt angegangen wird.
Was ist Arbeitskritik?
Mit Arbeitskritik oder „Postwork“ gibt es eine Strömung in der progressiven Debatte, die diese Problematik kritisch aufnimmt und ausgesprochen hilfreich ist, um sich einer Lösung nähern zu können. Was umfasst dieser Ansatz?
Arbeitskritik/Postwork baut auf eine alte intellektuelle Tradition neo-marxistischen, anarchistischen und feministischen Denkens auf und erlebt seit einiger Zeit in künstlerischen, aktivistischen und sozialwissenschaftlichen Kontexten einen neuen Aufschwung. Gemeint ist im Kern eine Kritik an der Zentralität moderner Arbeit und damit verbunden an den Strukturen und Sozialbeziehungen der modernen Arbeitsgesellschaft. Zudem geht es – ähnlich der Logik der Wachstumskritik – um Kritik an der kulturellen oder ideologischen Basis dieser Gesellschaft: der eben genannten modernen Arbeitsethik, einer Moral, die Arbeit als Selbstzweck ansieht, als moralische Pflicht, als von herausragender Bedeutung für menschliche Entfaltung, und als etwas intrinsisch Gutes, egal was getan wird.
Auch die allgemeine Neigung, jede denkbare Tätigkeit Arbeit zu nennen, kann als Ausdruck dieser kulturellen Überhöhung von Arbeit gelten. Obwohl allgemein als natürlich angenommen, ist diese Art der sozialen Organisation, ihre Institutionen, Sozialbeziehungen und Phänomene wie Lohnverhältnis, Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, abstrakte Zeit oder Glorifizierung von „Arbeit um der Arbeit willen“, historisch und kulturell eindeutig eine Ausnahme menschlichen Zusammenlebens.
Arbeitskritik oder Postwork ist allerdings nicht nur kritische Haltung. Sie untersucht auch, wie die moderne Arbeitsgesellschaft emanzipatorisch transformiert werden kann. Der Fokus liegt dabei nicht zwingend darauf, Arbeit pauschal abzuschaffen, sondern eher darauf, ihre gnadenlose Zentralität klar zu benennen und zu hinterfragen, und herauszufinden, wie eine freiere, menschlichere, demokratischere und nachhaltigere Form des Zusammenlebens und Arbeitens verwirklicht werden kann, inklusive aller Fragen und Debatten, die sich daraus ergeben.
Inwiefern kann Arbeitskritik ökologisch hilfreich sein?
Arbeitskritik/Postwork bereichert Nachhaltigkeits- und Klimadebatten um wertvolle und dringend benötigte neue Perspektiven; hier liegt das Hauptaugenmerk wieder auf ökologischen Aspekten.
Ökologische Arbeitszeitverkürzung
Zunächst lenkt dieser Ansatz den Fokus weg von populären, aber letztlich oberflächlichen und unzureichenden Lösungsvorschlägen, wie etwa der Änderung des individuellen Konsumverhaltens, und öffnet konzeptionellen Raum für eine Verständigung über Arbeit als zentrales, aber vernachlässigtes Nachhaltigkeitsproblem. In ökologischer Hinsicht erleichtert das die dringend nötige substanzielle Reduktion von Arbeit und Produktion – Arbeitszeitverkürzung ist eines der Hauptanliegen von Postwork.
Ein mit verbleibenden CO2-Budgets vereinbares Maß an Arbeitszeit bedeutet für Deutschland eine Wochenarbeitszeit von rund sechs Stunden
Während üblicherweise sehr stichhaltige soziale und ökonomische Argumente für eine Reduktion von Arbeit angeführt werden, wird immer deutlicher, dass auch eine funktionierende Klimapolitik um eine allgemeine und substanzielle Arbeitszeitverkürzung nicht herumkommt. Entsprechende Berechnungen zeigen, dass ein mit verbleibenden CO2-Budgets vereinbares Maß an Arbeitszeit für Deutschland eine Wochenarbeitszeit von rund sechs Stunden bedeutet – nicht am Tag, sondern in der Woche!
Aktuelle Debatten um die Einführung einer 4-Tage-Woche oder „gerechte Übergänge“ und „Klimajobs“ sind daher zwar zu begrüßen, werden überwiegend aber dem Ausmaß und der Dringlichkeit der ökologischen Herausforderungen nicht gerecht. Dennoch bleibt zu betonen, dass das 19. und 20. Jahrhundert hindurch Arbeitszeitverkürzung immer eine der gewerkschaftlichen Hauptforderungen und Teil der meisten parteipolitischen Programme sowie die Idee allgemein anerkannt war, dass steigende Produktivität kürzere Arbeitszeiten bedeutet. Hieran ließe sich problemlos wieder anknüpfen.
Welche Arbeit braucht eine Gesellschaft – und welche nicht?
Vieles spricht dafür, Arbeit nicht pauschal zu reduzieren, sondern je nach Umweltauswirkungen der Branchen und Industrien sowie der Möglichkeit, Arbeit auf Basis erneuerbarer Energien zu organisieren und umzuverteilen. Aber welche Arbeit in welchen Sektoren sollte konkret reduziert werden, und wer entscheidet darüber?
In entsprechenden Debatten heißt es üblicherweise, schädliche und sinnlose Arbeit sollte reduziert werden – aber welche Arbeit ist sinnlos und schädlich, welche ist überflüssig, welche fragwürdig, welche unabdingbar? Ernsthafte Diskussionen darüber werden durch die Unantastbarkeit von Arbeit oder „Vollbeschäftigung“ verhindert. Was es hier braucht, ist eine breite Debatte über die gesellschaftliche Notwendigkeit von Arbeit, über ihren Sinn und Zweck, und zwar institutionalisiert und damit auf Dauer gestellt in zu schaffenden Foren wirtschaftsdemokratischer Entscheidungsfindung. Teils hat diese Debatte schon begonnen, wie die Diskussion um „Bullshit Jobs“ zeigt (früher wurde auch schon mal über „socially useful production“ diskutiert). Postwork ist hier hilfreich, indem es die Politisierung von Arbeit fordert, weil gesellschaftliche Organisation und Konzeption von Arbeit soziale Konventionen und damit politisch sind, und entsprechend grundsätzlich zur Debatte stehen müssen.
Arbeitsmarkt vs. Wirtschaftsdemokratie
Eine Postwork-Perspektive ermöglicht auch, die Organisation von Arbeit neu zu überdenken: In der progressiven sozial-ökologischen Debatte gibt es (wie gerade angeklungen) plausible Argumente für die Einführung von Institutionen demokratischer Kontrolle über wirtschaftliche Macht und wichtige wirtschaftliche Entscheidungen, also eine Wirtschaftsdemokratie (was beispielsweise dringend geboten wäre, um das sehr knappe verbleibende CO2-Budget sinnvoll und fair verteilen zu können).
Faulheit ist die ökologisch verträglichste Daseinsform – und schon Aristoteles nannte Muße die Schwester der Freiheit
Dabei ist insbesondere eine Institution hinderlich, die relativ selten (selbst in kritischen Kreisen) als solche hinterfragt wird: der Arbeitsmarkt, ein Mechanismus, der Arbeit im Wettbewerbsmodus als künstlich verknappte „fiktive“ Ware je nach Verfügbarkeit von Geld und/oder Erwartung von Gewinn seitens sogenannter Arbeitgeber verteilt – und nicht nach Kriterien von Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Bedürfnissen. So lange nicht-nachhaltige oder gesellschaftlich sinnlose Jobs profitabel und/oder (gut) bezahlt sind, werden sie nach Marktlogik auch existieren, genauso wie „grüne Jobs“ diesen Kriterien entsprechen müssen, um geschaffen zu werden. Postwork hinterfragt diese Problematik und knüpft an Debatten über andere, de-kommodifizierte, demokratische und nachhaltige Formen der Organisation gesellschaftlich notwendiger Tätigkeit, Produktion und Versorgung an.
Das Humankapital schlägt zurück
Schließlich ist Arbeitskritik/Postwork als Ansatz hilfreich für ökologische Zwecke, weil damit die kulturelle Überhöhung von „harter Arbeit“ und Produktivismus problematisiert wird, und damit verbunden die Moralvorstellung, dass Faulheit und Inaktivität intrinsisch schlecht sind.
Postwork bietet eine andere Denkweise, wonach faul und unproduktiv sein sehr wertvoll sein kann. Faulheit oder die alte Idee der Muße ist ökologisch vorteilhaft, weil erwiesenermaßen nichts so klimaneutral und umweltfreundlich ist wie absolutes Unproduktivsein. Zeitnutzungsstudien zeigen, dass Muße, Ausspannen und sozialer Zeitvertreib sehr geringe ökologische Auswirkungen haben, und Schlafen praktisch gar keine – Faulheit ist also die ökologisch verträglichste Daseinsform.
Die arbeitskritische Debatte trägt auch zum Verständnis bei, welche Veränderungen in der Haltung zu Zeit, Effizienz und Faulheit die moderne Arbeitskultur überhaupt erst hervorgebracht haben. Sie kann dabei auf eine sehr alte Tradition zurückgreifen, in der Muße – und nicht Hamsterrad, Termindruck, Burnout und unendliche To-Do-Listen – immer das höchste soziale Ideal war und als wesentlich für die Verwirklichung von Freiheit und einem guten Leben betrachtet wurde; schon Aristoteles nannte Muße die Schwester der Freiheit.
Für eine effektive Klimapolitik wäre also sehr wirksam: die (Wieder-)Entdeckung von Faulheit, Karriereverweigerung, Konkurrenzverschlafen (überhaupt viel mehr schlafen) und Generalstreik als politische Mittel – zum einen um Sand ins Getriebe eines immer destruktiver werdenden Systems zu streuen, zum anderen als unmittelbare Klimaschutzmaßname: Dinge einfach sein lassen, bewusstes Nichts-Tun und kollektives Aufhören wären ökologisch sehr vorteilhaft und, wie Greta Thunberg jüngst erklärte, die einzige wirksame Klimaschutzmethode, die heute in großem Maßstab verfügbar ist.
Es sollte uns zu denken geben, dass die „vorindustrielle“ Zeit ein entscheidender Referenzpunkt für die Klimawissenschaft ist
Thunberg fügte allerdings auch hinzu, dass die Vorstellung einer Maßnahme, für die man nichts bauen, investieren oder kaufen muss, für viele nicht nur unrealistisch ist, sondern quasi einen gedanklichen Kurzschluss erzeugt. Zu sehr ist der moderne Mensch wohl davon überzeugt, dass eine sinnvolle Maßnahme mit Produktivität und Aktivität einhergehen muss (Ivan Illich nannte das solving by escalation). Es sollte uns jedenfalls zu denken geben, dass die „vorindustrielle“ Zeit ein entscheidender Referenzpunkt für die Klimawissenschaft ist.
Fazit
Weshalb also standen im Frühjahr 2020 die Raffinerien still, ging der Energieverbrauch zurück und sanken die Emissionen? Ein wichtiger Teil der Antwort: weil deutlich weniger gearbeitet wurde. Allerdings nicht in allen Bereichen: Zeitweilig wurden ganze Volkswirtschaften in Hinblick darauf umorganisiert, welche Industrien und Arbeitsfelder unmittelbar gesellschaftlich notwendig sind, gegenüber solchen, die verzichtbar sind und daher wenigstens für einige Zeit ihren Betrieb zurückfahren oder einstellen mussten.
ArbeiterInnen streikten für die Schließung von Fabriken, weil ihre Jobs sowohl unnötig als auch gefährlich sind, Unternehmen stellten freiwillig die Produktion um, um gesellschaftlich notwendige Dinge herzustellen. Menschen, die in „systemrelevanten“ Berufen arbeiten, bekamen plötzlich Applaus und neue Wertschätzung. So gab es nicht nur Debatten über die übliche (auch finanzielle) Geringschätzung dieser Arbeiten, sondern auch ein neues, breites Bewusstsein über den sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Wert verschiedener Arten von Arbeit.
Um die Klimakrise zu bewältigen, müsste genau hier weitergedacht und -gemacht, bzw. weiter aufgehört werden. Ob es gelingen wird, ist offen. In der Auseinandersetzung um eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft jedenfalls ist die Kritik an Arbeit eine unerlässliche Perspektive.
Zur Autorin:
Maja Hoffmann ist Doktorandin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie forscht zu Arbeit und Arbeitskritik im Kontext von sozial-ökologischer Transformation und postkolonialer Theorie.
Hinweis:
Dieser Beitrag basiert auf einem im Fachmagazin Environmental Sociology erschienenen Aufsatz.