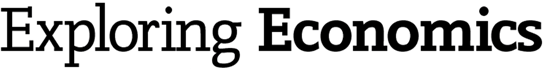Die (selbstauferlegten) Grenzen der Wissenschaft

Bild: CHUTTERSNAP via Unsplash
Economists for Future, 2023
Die (selbstauferlegten) Grenzen der Wissenschaft
Stephan Pühringer und Carina Altreiter
Erstveröffentlichung im Makronom
Die moderne Akademia bietet keine guten Rahmenbedingungen für gesellschaftskritische Transformationsforschung. Eine Reform sollte an vier Punkten ansetzen. Ein Beitrag von Stephan Pühringer und Carina Altreiter.



![]()
Unsere Gesellschaft befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Transformationsprozesses. Im Zentrum: die Wirtschaft. Die nächsten Jahre werden entscheiden, ob uns der Wandel by disaster passiert oder uns by design gelingt. Die Debattenreihe Economists for Future widmet sich den damit verbundenen ökonomischen Herausforderungen. Sie beleuchten einerseits kritisch-konstruktiv Engführungen in den Wirtschaftswissenschaften sowie Leerstellen der aktuellen Wirtschaftspolitik. Andererseits diskutieren wir Orientierungspunkte für eine zukunftsfähige Wirtschaft und setzen Impulse für eine plurale Ökonomik, in der sich angemessen mit sozial-ökologischen Notwendigkeiten auseinandergesetzt wird.
Eine der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist der sozialökologische Wandel und die Transformation. Dabei geht es um die Neuorganisation der aktuellen sozioökonomischen Strukturen und Institutionen auf eine Weise, die mit den sozialen und ökologischen Grenzen vereinbar ist. Obwohl vereinzelt einige Entwicklungen auf eine Krise des Vertrauens in Expert:innenwissen hindeuten (wie etwa Klimawandel-Leugnung, Fake News oder Covid-Proteste), wird die existenzielle Bedrohung der menschlichen Lebensgrundlage aufgrund des rapide fortschreitenden Klimawandels und des weitreichenden Verlusts der Biodiversität in akademischen und politischen Debatten mehrheitlich nicht grundlegend in Frage gestellt.
Die sozialökologische Transformation ist jedoch ein äußerst komplexes Thema, da hier verschiedene Prozesse miteinander verflochten sind. Dazu zählen beispielsweise die Mehrdimensionalität und Ko-Evolution, die Beteiligung verschiedener Akteur:innen, Stabilität und Veränderungsdynamiken, Pfadabhängigkeiten, langfristige Auswirkungen, (fundamentale) Unsicherheit, politische Machtasymmetrien sowie normative Grundlegungen, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Dimensionen umfassen. Planetare Grenzen und ökologisch irreversible Kippunkte wurden vor allem in den Naturwissenschaften ausgiebig untersucht und dargestellt.
Die multiplen Interdependenzen der sozialökologischen Transformation erfordern dagegen sozialwissenschaftliche und ökonomische Forschungsansätze, die mainstreamökonomischen Kernannahmen wie Wirtschaftswachstum, privates Eigentum, Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz, methodologischem Individualismus und lokale Nichtsättigung von Konsumpräferenzen in Frage stellen oder diesen entgegenstehen. Ökonomische Ansätze, die diese Problemstellungen stärker ins Zentrum stellen, wie Suffizienzpolitik und -ökonomie, Doughnut-Economics oder auch post- und de-growth Ansätze, haben bisher wenig Eingang in akademische Debatten gefunden. Dringend notwendige Transformationsforschung muss dabei inter- und transdisziplinär, radikal innovativ und multiperspektivisch sein, und insbesondere auch langfristige Forschungsagenden umfassen.
In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, warum das derzeitige universitäre Wissenschaftssystem und seine inhärenten wettbewerbsorientierten Evaluationsmechanismen in vielen Bereichen ungeeignet sind, um eine unterstützende Rolle bei der Transformation zu spielen, und – ökonomisch gesehen – die falschen Anreize für die Transformationsforschung setzen. Konkret sollen die ungenügenden Voraussetzungen für gesellschaftskritische Transformationsforschung unter den institutionellen Rahmenbedingungen kapitalistischer Universitäten beleuchtet werden, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch neoliberale Umstrukturierungen und Universitätsreformen geprägt wurden.
Managerial Turn und Verwettbewerblichung der Hochschulen
Der managerial turn hat auf Basis der neoliberalen Kritik an der mangelnden „Effektivität“, „Produktivität“ und „Leistungsfähigkeit“ staatlicher Hochschulen eine Transformation des universitären Selbstverständnisses von einer staatlichen Bildungseinrichtung hin zu wettbewerbsfähigen Unternehmen vollzogen (siehe die umfangreichen Arbeiten zum „Akademischen Kapitalismus“ von Richard Münch). Der managerial turn in der Hochschulbildung stützt sich daher stark auf die Anwendung standardisierter bibliometrischer Evaluationsmethoden, die seit den 1960er Jahren entwickelt wurden. Dazu gehören zum Beispiel der Science Citation Index (SCI), der Journal Impact Factor sowie die Erweiterung der Datenbank Web of Science.
Somit wurde es möglich, den wissenschaftlichen Output in Form von Zitations- und Impact-Scores zu messen, wodurch eine metric tide in Gang gesetzt wurde. Durch die Digitalisierung von Publikationsorganen und den damit verbundenen bibliometrischen Informationen sind Indikatoren und Zitationsmaße (z.B. der Hirsch-Index) zu einer leicht zugänglichen Quelle für die wettbewerbsorientierte Organisation der Qualitätskontrolle und damit der Stratifikationsdynamik in der Wissenschaft geworden.
Dadurch intensivierten sich zunehmend die wettbewerbsförmigen Beziehungen zwischen akademischen Einrichtungen und einzelnen Wissenschaftler:innen. Zugleich sind Universitäten im deutschsprachigen Raum noch immer weitreichend vom Modell der Ordinarienuniversitäten mit starkem hierarchischem Gefälle geprägt, Tilman Reitz spricht hier von „Verhofung“ und „Disziplinierung“ moderner Universitäten. In vielen Bereichen verbinden Universitäten ein problematisches Neben- und Miteinander von neo-feudaler Herrschaftslogik mit neoliberaler Flexibilisierung und Prekarisierung. Damit verknüpfen sie das Schlechteste dieser beiden Welten und bilden wohl kaum einen guten Nährboden für gesellschaftskritische und zukunftsgerichtete Transformationsforschung.
Die mit dem managerial turn in Gang gesetzte Wettbewerbsorientierung in der Governance von Hochschulen hat eine competition ecology (Wettbewerbsökologie) geschaffen, die auf verschiedenen ontologischen Ebenen wirkt. Dieser sehen sich immer mehr Forschende und akademische Institutionen ausgesetzt. So konkurrieren Forscher:innen auf Mikroebene um Sichtbarkeit, Forschungsmittel und (unbefristete) Stellen. Auf Mesoebene kämpfen Universitäten um Positionen, Sichtbarkeit, Studierende und Forschungsmittel, während auch Staaten etwa um Exzellenzcluster konkurrieren.
Im Zuge dieser Entwicklung kam es in Deutschland und Österreich in den letzten Jahren zu einer massiven Ausweitung von Drittmittel-Forschung und Projektmitarbeiter:innen. Damit verbunden ist auch eine immer stärkere Projektifizierung von Wissensproduktion, sprich eine Forschungsorganisation, die sich auf die Lösung klar abgesteckter Forschungsfragen in gegebenen und oft engen Zeitrahmen konzentriert. Damit einher geht ebenfalls die immer stärkere Output-Orientierung von Wissensproduktion, die unter dem Ausdruck „publish or perish“ von vielen Seiten kritisiert wird.
Die Kosten des Wettbewerbs
Die weitgehende Verwettbewerblichung von Wissenschaft auf diesen unterschiedlichen Ebenen setzt viele negative Anreize in der Wissensproduktion. Sie führt außerdem zu hohen Kosten des Wettbewerbs in mindestens drei Bereichen: wissenschaftlich-epistemologische, soziale und psychologische, sowie ökonomische Kosten des Wettbewerbs.
Als wissenschaftlich-epistemologische Kosten des Wettbewerbs können sowohl die Projektifizierung von Forschung an sich, aber auch die mangelnde Innovationsfähigkeit von Wissenschaft betrachtet werden, wie kürzlich in einer Studie in Nature dargelegt wurde. Weiterhin kann auch die Replikationskrise der Sozialwissenschaften und die Marginalisierung von heterodoxer Forschung abseits des ökonomischen Mainstreams als Folge der Metrifizierung der Forschungsevaluation und des damit verbundenen Publikationsdrucks gesehen werden.
Unter sozialen und psychologischen Kosten des Wettbewerbs verstehen wir die hohe Belastung mit Stress und psychischen Problemen, die laut mehreren aktuellen Studien insbesondere jüngere Forscher:innen betrifft, und auf eine „toxische Wissenschaftskultur“ zurückgeführt wird. Bedingt durch prekäre Arbeitsrealitäten an Universitäten zeigen sich zudem eine Reihe von sozialen Homogenisierungstendenzen entlang von Geschlecht, Herkunft und Klasse. So liegt der Frauenanteil unter Professor:innen in Deutschland und Österreich unter 30%, trotz verschiedener Gleichstellungsmaßnahmen.
Die ökonomischen Kosten des Wettbewerbs umfassen administrative und „Verfahrens“-Kosten. Diese beinhalten zunächst die Kosten des Nicht-Erfolgs, zu denen auch der Wert, der für Planung und Erstellung von Vorschlägen für nicht genehmigte, jedoch oft sehr gut bewertete Projekte gehört. Die Europäische Universitätsvereinigung schätzt, dass 30-50% der von den Ländern aus Horizon 2020 erhaltenen Mittel für die Deckung der Kosten aller Anträge verwendet werden, was an sich schon einen alarmierenden Anteil darstellt. Dazu kommen Kosten für das Verfassen von Gutachten zur Evaluierung von Anträgen: So wird für das britische Research Council im Jahr 2005/06 geschätzt, dass der Zeitaufwand für die Gutachten 192 Jahre betragen hat.
Neben diesen Umsetzungskosten kommen gerade im Bereich der kompetitiven Drittmittelvergabe auch noch administrative Kosten für die Prozessabwicklung auf verschiedenen bürokratischen Ebenen in unterschiedlichen Institutionen hinzu: von Universitäten, etwa Drittmittelstellen, Personalabteilungen, Forschungsservice, Rechtsabteilungen, bis hin zu nationalen und internationalen Förderstellen. Auf Basis der aktuellen Forschungslage in den hier angeführten drei Bereichen (Antragserstellung, Begutachtung und Administration/Organisation) lässt sich schätzen, dass nahezu 100% der über kompetitive Forschungsförderung vergebenen Drittmittel direkt oder indirekt für die Organisation und Umsetzung dieses Wettbewerbs verwendet werden. Hinzu kommen noch die Monopolrenten, welche Wissenschaftsverlage durch die Privatisierung von Wissensprodukten abschöpfen.
Die vier Ds einer kritischen, transformativen Akademia
Zusammenfassend hält die inhärente Wettbewerbslogik moderner kapitalistischer Akademia keine guten Rahmenbedingungen für gesellschaftskritische Transformationsforschung bereit. Vielmehr werden Inter- und Transdisziplinarität, Innovation und Forschung abseits des Mainstreams, Multiperspektivität und langfristige Forschungsagenden eher behindert als gefördert. Eine kritische Akademia, die besser geeignet wäre, Transformationsforschung zur Bewältigung der aktuellen Multikrisenphänomene zu unterstützen, müsste hingegen vor allem folgende vier Anforderungen erfüllen:
Erstens, die Dekommodifizierung der Hochschule: Dazu gehören insbesondere die Ent-Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen für Forscher:innen, die es ermöglichen, langfristige Forschungsperspektiven zu entwickeln und zu verfolgen und auch Möglichkeiten des Scheiterns ernst zu nehmen. Damit einher gehen muss eine Abkehr von bisherigen metrifizierten Leistungs- und Bemessungslogiken und eine Veränderung der Anerkennungs- und Verteilungsmechanismen im Wissenschaftssystem, um Forschung, Lehre und Wissenstransfer gleichermaßen einzubeziehen.
Zweitens, die Demokratisierung der Hochschulen: Die inneruniversitäre Entscheidungsfindung erfolgt in aktuellen Universitäten nicht oder allenfalls vor-demokratisch. So besteht im mehrstufigen, hierarchischen System der Kurien eine Machtasymmetrie, die Abhängigkeiten verschärft und intransparente Netzwerkstrukturen begünstigt – in vielen Fällen zum Nachteil jener sozialen Gruppen, die nicht die nicht dem hegemonialen Personenkreis an Universitäten angehören, wie etwa Frauen, Personen aus weniger privilegierten Klassenlagen oder Migrationsbiographien.
Drittens, Diversität und Inklusion: Diversität bezieht sich dabei sowohl auf das gleichberechtigte Zusammenwirken unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen und der Förderung des inter- und transdisziplinären Dialogs, als aber auch auf die Förderung diverser Karriereprofile, wie es jüngst auch in der CoARA-Initiative (Coalition for Advancing Research Assessment) der EU-Kommission eingefordert wurde. Einen Schritt in diese Richtung stellt der Zusammenschluss von öffentlichen Forschungseinrichtungen in den Niederlanden mit ihrem Ziel des „Redesigning academic career paths“ dar.
Viertens, Stärkung des Dialog der Wissenschaft mit der Gesellschaft: Dem Beispiel der Forderung einer public sociology von Burawoy folgend, müssen Auseinandersetzungen mit nicht-wissenschaftlichen gesellschaftlichen Akteur:innen verstärkt werden. Während es zwar gerade im Bereich der Third-Mission als neues Leistungsziel Bestrebungen in Richtung einer Höherbewertung von Wissenstransfer gibt, sollen hier aber keine neuen Logiken des Wettbewerbs (z.B. Anzahl an Medienauftritten, Zeitungskommentare und der gleichen) implementiert werden. Stattdessen fordert Burawoy die Verstärkung des Austauschs und wechselseitiger Lernprozesse, insbesondere Teile der Zivilgesellschaft betreffend, die normalerweise nicht im Fokus des öffentlichen Medieninteresses stehen, wie lokale communities, Vereine, Gewerkschaften oder soziale Bewegungen.
Eine Universität des 21. Jahrhunderts, die für die großen Herausforderungen der Zukunft gerüstet ist, muss somit nicht nur die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft wahrnehmen, sondern sich auch aktiv gegen den Wachstumszwang kapitalistischer Kapitalakkumulation positionieren, um Räume für innovative und transformative Wissensgenerierung zu schaffen.
Zu den AutorInnen:
Stephan Pühringer ist Sozioökonom und stellvertretender Leiter des Instituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft (ICAE) an der Johannes Kepler Universität Linz. Derzeit leitet er das interdisziplinäre FWF-Zukunftskolleg SPACE. Seine Forschungsinteressen umfassen Kritische Wettbewerbsforschung, die politische Ökonomie der Sozialökologischen Transformation, Wissenschaftsforschung, sowie Neoliberalismusstudien.
Carina Altreiter ist Soziologin an der Wirtschaftsuniversität Wien und forscht zu den Themen Transformation der Arbeitswelt, soziale Ungleichheit, politische Verarbeitung des sozio-ökonomischen Wandels und Verwettbewerblichungsprozessen.