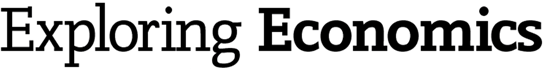Das Politische des Ökonomischen wiederentdecken
Economists for Future, 2019




Im Angesicht der Klimakrise und der Fridays-for-Future-Proteste hat das Netzwerk Plurale Ökonomik unter #Economists4Future dazu aufgerufen, Impulse für neues ökonomisches Denken zu setzen und bislang wenig beachtete Aspekte der Klimaschutzdebatte in den Fokus zu rücken. Dabei geht es beispielsweise um den Umgang mit Unsicherheiten und Komplexität sowie um Existenzgrundlagen und soziale Konflikte. Außerdem werden vielfältige Wege hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaftsweise diskutiert – unter anderem Konzepte eines europäischen Green New Deals oder Ansätze einer Postwachstumsökonomie. Hier finden Sie alle Beiträge, die im Rahmen der Serie erschienen sind.
Das Politische des Ökonomischen wiederentdecken
Anil Shah
Erstveröffentlichung im Makronom
Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen 2018 diskutierte Olivier Blanchard, ehemaliger Chefökonom des IWF und Autor eines Standard- Lehrbuchs zur Makroökonomie, mit dem italienischen Ökonomen Emiliano Brancaccio über die Krisen unserer Zeit:
“I would like to start from the question of whether there are alternatives to capitalism. My answer is ‘No’, in the following sense. For me, it is obvious that the only non-chaotic way to organize economic interactions in a world populated by seven billion people is the use of markets.“ – Oliver Blanchard
Die Debatte stand im Kontext der Krise der Wirtschaftswissenschaften, in der die Dominanz einer bestimmten theoretischen und methodischen Perspektive innerhalb der Disziplin zunehmend in Frage gestellt wird.
Eine Woche zuvor hatte Greta Thunberg die internationale Politik auf der 24. Weltklimakonferenz in Katowice ermahnt, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen:
“We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find then maybe we should change the system itself.” – Greta Thunberg
Die zwei Beiträge scheinen zunächst nicht viel gemein zu haben. Doch im Kern dieser beiden Krisen geht es vor allem um die Frage, wie zukunftsfähig das vorherrschende Wirtschaftssystem ist.
Die Bewegung „Fridays for Future“ ist im Kern konservativ und radikal zugleich ist. Auf der einen Seite ist die Hauptforderung, bereits bestehende internationale Vereinbarungen (zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5℃) einzuhalten, vorrangig ein realpolitisches Ziel. Gleichzeitig scheint diese Forderung geradezu utopisch, weil keine der Maßnahmen aus Politik und Industrie in den vergangenen Jahrzehnten auch nur annähernd darauf hindeuten, dass dieses Ziel mit einem „weiter so“ zu erreichen wäre, es also einen radikalen Wandel braucht.
Wie ist dieses Paradox zu erklären? Warum sollte sich gerade #EconomistsForFutures dieser Frage annehmen? Und was sind Perspektiven, die eine kritische Gesellschaftsforschung dazu bieten kann?
Wirtschaften als Stoffwechsel mit der Natur
Im Kern geht es in der Debatte, wie eine Gesellschaft mit dem Klimawandel umgeht, vor allem um ökonomische Fragen. Denn wie Gesellschaften ihr Verhältnis zur nicht-menschlichen Mitwelt gestalten, hängt entscheidend davon ab, wie und unter welchen Voraussetzungen produziert wird – egal, ob es sich um Energie, Lebensmittel oder Mobilität handelt.
Aus der Perspektive der politischen Ökologie impliziert Wirtschaften immer ein bestimmtes gesellschaftliches Naturverhältnis. Das Überleben menschlicher Gesellschaften fußte stets auf der Aneignung und Bearbeitung von Land, Wasser und anderen Ressourcen. Karl Marx sprach deshalb Ende des 19. Jahrhunderts von der Arbeit als einem „Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein Prozeß, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert“. Die Metapher des Stoffwechsels zeigt die wechselseitige Abhängigkeit zwischen menschlichen Gesellschaften und dem was gemeinhin als „Natur“ bezeichnet wird.
Die zeitgenössische Ökologische Ökonomik hat in den vergangenen Jahren beunruhigende Befunde zum Charakter dieses Metabolismus vorgelegt. Trotz einer relativen Entkoppelung vom Wirtschaftswachstum steigt der absolute Ressourcenverbrauch weltweit mit beängstigender Geschwindigkeit. Rund ein Drittel aller Materialien, die seit 1900 abgebaut bzw. ausgestoßen wurden, sind zwischen 2002 und 2015 angefallen. Alles deutet darauf hin, dass der vorherrschende industrielle Metabolismus die „planetaren Grenzen“ in den kommenden 50 Jahren sprengen wird – es steht außer Frage, dass die von Menschen betriebenen ökonomischen Aktivitäten die Entwicklung des Planeten entscheidend prägen.
Die Widersprüche des Anthropozäns
Zahlreiche wissenschaftliche Studien sprechen daher vom „Anthropozän“ – einem Zeitalter, in dem der Mensch zu einer zentralen Kraft geworden ist, welche die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse des Planeten beeinflusst. Doch der Blick auf „die Menschheit“ als einheitliches Subjekt ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zunächst suggeriert diese Perspektive, dass alle Menschen in gleicher Weise mit diesem Wandel verbunden wären – sieben Milliarden Menschen werden also als individuelle Marktakteure gedacht, die in ihrem Sinne rational handeln, aber deren Entscheidungen auf aggregierter Ebene eben zu negativen Auswirkungen führen.
Die internationale Politik wird längst nicht mehr nur von Staaten geprägt und keineswegs nur in den Konferenzräumen internationaler Klimagipfel betrieben. Was dabei aus dem Blick gerät, ist die Dynamik einer Weltwirtschaft, in der ungleiche Macht- und Herrschaftsverhältnisse den Lauf der Wirtschaft und damit auch der gesellschaftlichen Naturverhältnisse bestimmen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Weltwirtschaft von einer beispiellosen Machtkonzentration transnationaler Unternehmen gekennzeichnet. Die internationale Politik wird daher längst nicht mehr nur von Staaten geprägt und keineswegs nur in den Konferenzräumen internationaler Klimagipfel betrieben. Die erbitterte Konkurrenz immer weniger Unternehmen führt dazu, dass Kosten um jeden Preis eingespart werden müssen.
Das heißt: Unternehmen bauen ihre Geschäftsmodelle systematisch auf dem Prinzip der Externalisierung auf, um fortbestehen zu können. Dies betrifft nicht allein die Fossilbrennstoff-Industrie. Die 20 größten Fleisch- und Milchkonzerne emittieren bereits heute mehr als ganze Industriestaaten (etwa Deutschland oder Australien) und sind bei weiterem Wachstum auf dem besten Weg, Erdölgiganten wie ExxonMobil, Shell oder BP in puncto Treibhausgasemissionen zu überholen. Dieser Umstand lässt sich kaum durch den bösen Willen geldgieriger Manager oder dem fehlenden Einpreisen von „externen Kosten“ erklären. Es stellt sich die Frage, welche ökonomischen Dynamiken dieses destruktive business as usual prägen?
Kapitalistische Naturverhältnisse
Die Spezifik der gegenwärtigen Produktionsweise liegt in der scheinbaren Trennung von materiellen Stoffen, die für die Herstellung von Gebrauchswerten (z.B. Fleisch als Lebensmittel) benötigt werden, und dem immateriellen Tauschwert, den diese Waren letztlich auf dem Markt erzielen. Sie wird gemeinhin als kapitalistische Produktionsweise bezeichnet, weil es im Produktionsprozess in erster Linie um die Verwertung von Geld geht, und nur sekundär um die Erfüllung von Bedarfen.
Die Schaffung von sogenanntem Mehrwert ist nur über die Ausbeutung von Arbeit und Natur möglich. Dies bedeutet auch, dass Kapitalakkumulation, also die Anhäufung immaterieller Werte mittels Warenproduktion, trotz Abhängigkeit eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber ihrer stofflichen Voraussetzung entwickelt. In den Worten der kritischen politischen Ökonomie, ist der gesellschaftliche Stoffwechsel von einem Riss durchzogen.
Dieser „metabolische Riss“ basiert nicht zuletzt auf sozialen Spaltungen. Durch strukturelle Herrschaftsverhältnisse basierend auf Klasse, Geschlecht und race nehmen Menschen ganz unterschiedliche Positionen in der globalen Ökonomie ein. Historisch gesehen haben diese sozialen Spaltungslinien Naturverhältnisse immer auch mitbestimmt. Insbesondere feministische und postkoloniale Studien konnten zeigen, dass Frauen und nicht-weiße Menschen in der Entwicklung des Weltmarktes seit dem 16.Jahrhundert meist Teil „der Natur“ waren und gerade deshalb besonders ausgebeutet werden konnten. Insofern scheint es absurd, von „der Menschheit“ als treibender Kraft des planetaren Wandels zu sprechen.
Der Begriff „Kapitalozän“ bringt dagegen das grundlegende Problem besser auf den Punkt. Denn hinter dem Riss im gesellschaftlichen Stoffwechsel steckt der Widerspruch zwischen der regenerativen Logik lebendiger Ökosysteme und dem maßlosen, expansiven Charakter der Kapitalakkumulation, dem sich einzelne Unternehmen letztlich kaum entziehen können. Entsprechend erfordert der Weg in eine zukunftsfähige Gesellschaft die Überwindung eben dieser Produktionsweise, die nicht nur die Lebensgrundlagen zerstört, sondern auch soziale Spaltungen in der Weltgesellschaft forciert.
Das Politische des Ökonomischen
Weite Teile der vorherrschenden Ökonomik haben Bewegungen wie „Fridays for Futures“ oder „Extinction Rebellion“ kaum relevantes Wissen anzubieten. Dies liegt vor allem an einem ideologisch verengten Blick auf das, was als ökonomisch bezeichnet wird, sowie den daraus resultierenden Maßnahmen. Märkte gelten in der vorherrschenden VWL als Synonym für Ökonomie.
Entsprechend bestehen politische Spielräume lediglich aus der Etablierung neuer Märkte und Anreize (bspw. Emissionshandel) oder der Einführung von Steuern (derzeit prominent: CO2-Steuer). Politik und Ökonomie sind insofern getrennt, als dass die zuvor diskutierte Wirtschaftsweise sowie die durch sie bedingten Beziehungen zur Mitwelt scheinbar überhaupt nicht zur Debatte stehen.
Wenn Schüler*innen freitags mit Schildern auf die Straßen gehen, auf denen „System Change, Not Climate Change“ steht, dann sollte dies auch eine Aufforderung an die Wirtschaftswissenschaften sein. Das Politische erschöpft sich nicht in Handlungsempfehlungen an Parlamente. Es umfasst vielmehr die Gesamtheit der öffentlich zu führenden Debatten über die Art und Weise, wie wir leben wollen, sollen und können. Und dazu gehört auch die Frage was, wie, von wem und unter welchen Bedingungen produziert werden sollte – vor allem in einer Zeit, die wahrscheinlich als das sechste große Massensterben in die Geschichte des Planeten eingehen wird.
Die industrielle Landwirtschaft oder die Automobilindustrie – egal ob mit Verbrennungsmotor oder Elektrobatterie – durch „grünes Wachstum“ auf einen nachhaltigen Entwicklungspfad zu führen, wird nicht funktionieren. Es braucht ein alternatives Wirtschaftssystem, in dem Produktions- und Naturverhältnisse nicht mehr von sozialen Spaltungen und dem maßlosen Streben nach Geldverwertung beherrscht werden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss sich die Ökonomik als Disziplin grundsätzlich wandeln, hin zu einer pluralistischen und transdisziplinären Gesellschaftswissenschaft wie der politischen Ökonomie.
Transformation denken
Selbstverständlich ist es weder wünschenswert noch realistisch, ein alternatives Wirtschaftsmodell allein am Reißbrett zu entwerfen. Die Geschichte zeigt, dass grundlegender Wandel vor allem von widersprüchlichen gesellschaftlichen Interessenskonflikten und Aushandlungsprozessen abhängt. Doch Ansatzpunkte und Vorstellungen von weniger gewaltsamen, genügsameren und solidarischeren Produktions- und Naturverhältnissen müssen überhaupt erst wieder denkbar sein und kollektive Vorstellungen von einem besseren Leben für alle prägen, damit es Chancen für eine Transformation gibt. Neue Formen von Wirtschaftsdemokratie gehören ebenso dazu wie die gelebte Praxis des Commoning sowie die Fokussierung auf Reziprozität und Reproduktion statt auf Wettbewerb und Profit.
Das Politische des Ökonomischen anzuerkennen und wiederzuentdecken, ist ein wichtiger Schritt, um eine gesellschaftliche Debatte über grundlegende wirtschaftliche Transformationen zu führen. Dabei gilt es ökonomische Expertise nicht nur in den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten zu suchen. Sowohl von anderen Gesellschaftswissenschaften (Soziologie, Politikwissenschaften, Anthropologie, Geographie, etc.), als auch von zivilgesellschaftlichen Initiativen werden seit Jahren andere Wirtschaftsformen und Beziehungen zur Mitwelt erforscht und praktiziert. Für #EconomistsForFuture ist dies insofern relevant, als dass dieses Wissen und diese Erfahrungen den vermeintlich neutralen und technischen Charakter aktueller Debatten zu Klimapolitik in Frage stellen und dabei zeigen, dass eine sozial-ökologische Transformation vielmehr als politisches und gesellschaftliches Projekt zu begreifen ist.
Zum Autor:
Anil Shah ist Teil des I.L.A. Kollektivs und arbeitet derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Globalisierung & Politik der Universität Kassel.
Der Autor dankt Anna Weber, Samuel Decker und den Organisator*innen der Reihe #EconomistsForFuture für wertvolles Feedback zu diesem Artikel.
Wir bieten eine Plattform für Artikel und Themen, die in der Mainstream-Ökonomik vernachlässigt werden. Dafür sind wir auf Unterstützung angewiesen.