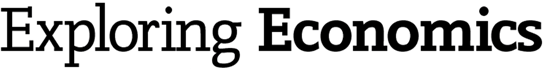Komplexitätsökonomik
Die Perspektiven der Pluralen Ökonomik
Perspektiven erkunden Perspektiven vergleichen
Dieser Text präsentiert eine Perspektive der Pluralen Ökonomik. Im Orientieren-Bereich kannst Du zehn verschiedene Perspektiven der Pluralen Ökonomik kennenlernen und vergleichen.
Autor*in: Joeri Schasfoort | 18. September 2017
vom Exploring Economics Team vom Originaltext ins deutsche übersetzt
1. Kernelemente
Die Komplexitätsökonomik untersucht Wirtschaftssysteme als komplexe Systeme. Komplexe Systeme bestehen aus interagierenden Individuen, die ihre Handlungen und Strategien als Reaktion auf die gemeinsam geschaffenen Ergebnisse anpassen (Arthur 2013). Komplexitätsökonom*innen erforschen die Entstehung von Strukturen und die Entwicklung von Mustern in der Wirtschaft und verzichten häufig auf die Annahmen individueller Optimierungsentscheidungen und/oder des systemischen Gleichgewichts, die in der Mainstream-Ökonomik üblich sind (Arthur 1999). Seit der Finanzkrise 2008, als Mainstream-Gleichgewichtsmodelle kaum politische Handlungsrichtungen aufzeigen konnten (Armstrong 2017), wächst das Interesse an Ideen aus der Komplexitätstheorie (Battiston et al. 2016).
2. Begriffe, Analyse, Konzeption der Wirtschaft
Komplexitätsökonom*innen betrachten die Wirtschaft als ein komplexes System, das aus anderen komplexen Systemen besteht und zu anderen komplexen Systemen gehört oder sich mit ihnen überschneidet.
In diesem System werden wirtschaftliche Muster wie Wirtschaftswachstum und Inflation als emergente Phänomene klassifiziert, da sie aus den Interaktionen heterogener und adaptiver Akteure mit unterschiedlichen Erwartungen hervorgehen (Kirman 2006, 2016). Eine breitere Definition eines emergenten Phänomens ist, dass es sich um ein „neues“ Muster handelt, das aus den Interaktionen einer Reihe von Elementen entsteht, zwischen denen einfache Beziehungen bestehen, das sich jedoch nicht auf die spezifischen Eigenschaften jedes dieser Elemente reduzieren lässt (Hayek 1964).
Komplexitätsökonom*innen wie Arthur (2013) argumentieren, dass sich die Wirtschaft natürlicherweise nicht im Gleichgewicht befindet. Die Wirtschaft befindet sich ständig im Fluss, entwickelt und verändert sich kontinuierlich. Laut Arthur (2013) gibt es hierfür zwei Hauptgründe: fundamentale Unsicherheit und technologische Innovation.
Das Konzept der (fundamentalen) Unsicherheit wurde in der Ökonomik von Knight (1921) und Keynes (1921, 1936, 1937) eingeführt. Sie unterschieden zwischen Risiko und Unsicherheit. Beim Risiko sind alle möglichen zukünftigen Ereignisse oder Konsequenzen einer Handlung oder Entscheidung bekannt. Daher können wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass dieses Ereignis tatsächlich eintritt. In vielen Situationen kennen wir jedoch nicht alle möglichen Ergebnisse. In solchen Unsicherheitssituationen hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung keine solide Grundlage.
Um mit Unsicherheit umzugehen, versuchen Wirtschaftsakteure, Probleme durch Vermutungen, Schätzungen, Erfahrungswissen (Arthur 2013) und einfache Entscheidungsheuristiken („Daumenregeln“, Gigerenzer & Gaissmaier 2011) zu bewältigen. Demzufolge aktualisieren Akteure fortwährend ihre internen Entscheidungsmodelle, passen ihre Handlungen oder Strategien an, verwerfen oder ersetzen sie basierend auf ihren Erfahrungen. Solche Dynamiken werden auch als „evolutionäre Dynamiken“ bezeichnet (Lindgren 1997). Lindgren (1997) zeigt mithilfe der evolutionären Spieltheorie, dass evolutionäre Modelle in Gegenwart von Störfaktoren meist nicht in einem stabilen Nash-Gleichgewicht enden. Wenn diese Ergebnisse auf die gesamte Wirtschaft übertragbar sind, sollte sie aufgrund des Lernens und Anpassens der Akteure permanent in disruptiver Bewegung sein.
Technologische Innovation ist der andere wichtige Faktor, der zu einem permanenten Fluss (‚permanent state of flux‘) des Wirtschaftssystems beiträgt. Es liegt in der Natur der Innovation, dass technologische Entwicklungen weitere technologische Entwicklungen ermöglichen (Arthur 2013). Eine neue Technologie stört daher nicht nur einmalig das Gleichgewicht, sondern wirkt als permanenter Generator und Nachfrager weiterer Technologien, die ihrerseits wiederum weitere Technologien hervorbringen (Arthur 2009). So trägt auch technologische Innovation zum permanenten Fluss bei, wenn auch langsamer als Unsicherheit.
Dennoch ist diese Dynamik oft relativ stabil und kann daher durch ein Gleichgewicht oder einen stationären Zustand angenähert werden. Dieses Gleichgewicht ist jedoch häufig nicht eindeutig, da komplexe Systeme oft durch multiple Gleichgewichte gekennzeichnet sind, insbesondere bei positiven Rückkopplungen oder steigenden Skalenerträgen (Bosker et al. 2007).
Der stationäre Zustand, in dem ein komplexes System endet, hängt vom Pfad zu diesem Zustand ab – er ist pfadabhängig. Die resultierende Dynamik kann verschiedene Formen annehmen: Das System kann sich auf einem ausgeglichenen Pfad einem einzigen Gleichgewicht nähern (der oft im Mainstream angenommen wird), aber es gibt auch oszillierende oder sogar chaotische Dynamiken, die in der Komplexitätsökonomik eine zentrale Rolle spielen. Im letzteren Fall können winzige Änderungen der Anfangsbedingungen dazu führen, dass das System in einem radikal anderen stationären Zustand endet (Li und Yorke 1975).
Sobald ein System einen stationären Zustand erreicht hat, ist der Übergang zu einem anderen Zustand nicht immer einfach. Es kann so widerstandsfähig gegen Veränderungen sein, dass erhebliche Schocks nötig sind, um es in ein anderes Regime zu überführen („Lock-in“, Arthur 1989). Andererseits kann ein System, dessen Resilienz abnimmt, einen Kipppunkt erreichen und plötzlich sein Verhalten ändern oder in ein anderes Regime wechseln (Battiston et al. 2016). Finanzmärkte und Volkswirtschaften haben in der Geschichte plötzliche und weitgehend unvorhergesehene Zusammenbrüche auf systemischer Ebene erlebt. Solche Phasenübergänge wurden in einigen Fällen durch unvorhersehbare stochastische Ereignisse ausgelöst, häufiger jedoch durch endogene Prozesse (Battiston et al. 2016).
Zusammenfassend betrachten Komplexitätsökonom*innen die Wirtschaft als ein komplexes System. Aggregierte ökonomische Phänomene werden als Muster verstanden, die aus den Interaktionen heterogener Akteure entstehen. Wirtschaftssysteme können sich zwar in relativ stabilen Zuständen befinden, die durch ein Gleichgewicht angenähert werden können, doch Unsicherheit und technologische Innovation sorgen dafür, dass sie sich ständig im Fluss befinden. Darüber hinaus sind stabile Zustände oft nicht eindeutig, pfadabhängig und manchmal sogar chaotisch. Zudem durchlaufen Wirtschaftssysteme regelmäßig Phasenübergänge, die in einen anderen Zustand münden. Um diese Dynamiken angemessen darzustellen und zu untersuchen, verwendet die Komplexitätsökonomik Methoden und Theorien, die üblicherweise als „breiter“ gelten als im Mainstream.
Es gibt noch so viel zu entdecken! 🚀
Im Entdecken-Bereich haben wir hunderte Videos, Texte und Podcasts zu ökonomischen Themen gesammelt. Außerdem kannst du selber Material vorschlagen!
Material entdecken Material vorschlagen
3. Ontologie
Die Sichtweise der Komplexitätsökonom*innen auf die Wirtschaft ähnelt dem Konzept des Systemismus (Bunge 1996; Gräbner & Kapeller 2015), wonach eine Gesellschaft ein geschichtetes System aus sich verändernden Subsystemen ist, mit globalen Eigenschaften (reduzierbar und nicht-reduzierbar) und sowohl aufwärts- (z. B. von Individuen zu sozialen Strukturen) als auch abwärtsgerichteten Effekten (z. B. von Institutionen auf Individuen).
Komplexe Wirtschaftssysteme überschneiden sich mit anderen komplexen Systemen, jedoch nicht immer hierarchisch. Stattdessen können diese überlappenden Systeme als Panarchie beschrieben werden (Holling 2001), eine Struktur, in der Systeme durch adaptive Zyklen von Wachstum, Akkumulation, Restrukturierung und Erneuerung verbunden sind. Komplexe Systeme haben also komplexe Systeme über und unter sich und sind gleichzeitig Teil mehrerer überlappender komplexer Systeme.
Innerhalb eines komplexen Systems identifizieren Dopfer et al. (2004) drei Ebenen, die seine Dynamik antreiben: Mikro- (Individuen), Meso- (Regeln) und Makroebene (System). Auf jeder Ebene finden unterschiedliche Entscheidungen und Interaktionen statt. Die genaue Zuordnung hängt vom Untersuchungsgegenstand ab. Beispielsweise ordnen Commendatore et al. (2018) in der Räumlichen Ökonomik Interaktionen internationaler und regionaler Handelspartner der Makroebene, Märkte als soziale Netzwerke der Mesoebene und strategische Entscheidungen von Haushalten und Unternehmen der Mikroebene zu.
Auf der Mikroebene gelten Akteure als begrenzt rational (Simon 1972). Ihre Rationalität ist durch die Komplexität des Problems, kognitive Grenzen und Zeit beschränkt (Simon 1991). Laut Arthur (2010) optimieren Individuen nicht (z. B. Nutzen), sondern nutzen kognitive Prozesse wie sozialen Vergleich, Imitation und Gewohnheiten, um ihre begrenzten Ressourcen effizient einzusetzen (Jager et al. 2000; Gigerenzer & Gaissmaier 2011).
Auf allen drei Ebenen spielt Zeit aufgrund von Pfadabhängigkeit eine wichtige Rolle. Jeder Zustand eines Wirtschaftssystems baut auf vergangenen Zuständen auf. So wird die Wirtschaft zu einem prozeduralen, algorithmischen System (Arthur 2013). Da komplexe Systeme ständig im Fluss sind, ist das Verständnis dieses kontinuierlichen Wandels das zentrale Problem der Komplexitätsökonomik.
4. Epistemologie
Unter Komplexitätsökonom*innen herrscht kein Konsens darüber, wie wir unser komplexes Wirtschaftssystem verstehen können, obwohl die überwiegende Mehrheit darin übereinstimmt, dass Modelle für die Untersuchung komplexer Systeme unerlässlich sind. Darüber hinaus lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: eine bescheidene (‚modest group‘) und eine optimistische. Die bescheidene Gruppe glaubt, dass ihre Modelle kausale Mechanismen hinter häufig beobachteten ökonomischen Mustern aufdecken können, aber dass die Realität zu komplex ist, um mit diesen Modellen nützliche Vorhersagen über die Wirtschaft zu treffen. Die optimistische Gruppe glaubt, dass ihre Modelle zusätzlich dazu genutzt werden können, solche Vorhersagen zu machen, auch wenn diese wahrscheinlich nicht sehr genau sein werden. Im Folgenden werde ich zunächst die Erkenntnistheorie der bescheidenen Gruppe und dann die der optimistischen Gruppe diskutieren.
Die bescheidene Gruppe argumentiert, dass es aufgrund der enormen Komplexität der Wirtschaft unmöglich ist, universell gültige Wirtschaftsgesetze abzuleiten. Stattdessen sollten Komplexitätsökonom*innen dieser Tradition nach mechanismusbasierten Erklärungen (Gräbner 2017) streben, und ihre Modelle sollten danach beurteilt werden, inwieweit sie die Mechanismen aufdecken können, die gängige ökonomische Muster hervorbringen.
Der Einfluss der bescheidenen Sichtweise zeigt sich deutlich in Epsteins (2006) Vision der generativen Sozialwissenschaften. In dieser Vision besteht die Aufgabe des Komplexitätsökonom*innen darin, Prozesse computergestützt zu generieren. Dies ist der einzige Weg, um sie zu verstehen: „If you grow it, you show it.“ („Wenn man es erzeugt, kann man es zeigen.“).
Ähnlich äußern Komplexitätsökonom*innen, die von der österreichischen Tradition beeinflusst sind, eine tiefe Skepsis darüber, wie viel wir über die Welt verstehen – geschweige denn vorhersagen – können, und plädieren stattdessen für Bescheidenheit (Hoogduin 2016). Hayek (1964) führt drei Gründe dafür an: Erstens ist die Anzahl der Variablen, die zur Erklärung komplexer ökonomischer Phänomene benötigt werden, oft so groß, dass sie praktisch (und vielleicht sogar theoretisch) unmöglich zu erfassen ist. Zweitens kann die Überlappung komplexer Systeme – enge Kopplung – zu unerwarteten Interaktionen führen, die von ökonomischen Modellen nicht antizipiert wurden. Drittens zeigen viele komplexe Systeme eine Sensitivität gegenüber Anfangsbedingungen, was es sehr unwahrscheinlich macht, dass Modelle mit den richtigen Anfangsbedingungen kalibriert werden, um nützliche Prognosen zu liefern.
Auf diese Weise unterscheiden sich die Wirtschaftswissenschaften (und andere Sozialwissenschaften) von den „harten“ Wissenschaften, die sich mit Phänomenen befassen, die vergleichsweise einfach sind. Der Preis, den wir für das Vordringen in den Bereich komplexer Phänomene zahlen, ist, dass wir zunehmend die Fähigkeit verlieren, nützliche Vorhersagen zu treffen. Dies liegt daran, dass die Anzahl der Variablen im System steigt, es zu mehr Systemüberlappungen kommt und die Sensitivität gegenüber Anfangsbedingungen zunimmt. Während beispielsweise langfristige Wettervorhersagen ungenau sind, ist kaum zu leugnen, dass sie nützliche kurzfristige Prognosen liefern, auf die sich täglich Millionen von Menschen verlassen. Daher argumentieren einige Komplexitätsökonom*innen der österreichischen Tradition (Gaus 2007), dass die Wirtschaft kein zu komplexes System ist, um überhaupt nützliche Vorhersagen zu treffen – es sollte nur explizit über die Unsicherheit dieser Prognosen gesprochen werden.
Dies bringt uns zur optimistischen Gruppe der Komplexitätsökonom*innen, die argumentiert, dass ihre ökonomischen Modelle anhand ihrer Vorhersagefähigkeit beurteilt werden sollten. Diese Ansicht über die Aussagekraft ökonomischer Modelle entspricht eher der Perspektive bekannter, aber dennoch pragmatischer Ökonom*innen wie Rodrik (2015). Arthur (2005) schlägt vor, dass wir mit den richtigen Werkzeugen – denen der Komplexitätsökonomik – in der Lage sind, zu untersuchen, wie sich die Wirtschaft außerhalb des Gleichgewichts verhält. Dies ergibt sich natürlich aus der Überlegung, dass die Komplexitätsökonomik eine Wirtschaftstheorie auf einer allgemeineren, nicht-gleichgewichtigen Ebene ist (Arthur 1999). Farmer und Foley (2009) argumentieren, dass es mit den aktualisierten Modellen der Komplexitätsökonomik möglich wäre, die Auswirkungen politischer Szenarien auf makroökonomischer Ebene quantitativ zu untersuchen. Somit sind unsere derzeit begrenzten ökonomischen Prognosefähigkeiten eine Folge davon, dass der falsche Ansatz zu ihrer Untersuchung verwendet wird.
Die meisten Komplexitätsökonom*innen der optimistischen Tradition sind dennoch recht bescheiden. Sie argumentieren, dass ihre Modelle nur zuverlässig bedingte Vorhersagen (Haldane & Turrell 2018) liefern können – also was wahrscheinlich mit Y passiert, wenn sich X ändert. Dies steht im Gegensatz zu unbedingten Vorhersagen, die aussagen, welchen Wert Y annehmen wird, abhängig von den Prognosen aller X-Variablen, die Y beeinflussen können (Simon Wren-Lewis 2014).
Die beiden in diesem Abschnitt diskutierten Ansichten sind nicht vollständig binär. Sie können als ein Spektrum von bescheiden bis optimistisch betrachtet werden. Es lässt sich sagen, dass Komplexitätsökonom*innen – obwohl sie fast ausschließlich Modelle für ihre Studien verwenden – im Durchschnitt bescheidener sind als ihre Mainstream-Kollegen, weil sie die Welt als komplexes System anerkennen.
5. Methodologie
Wie bereits erwähnt, beobachten Komplexitätsökonom*innen im Allgemeinen emergente Muster und entwickeln dann Modelle, die die zugrunde liegenden Mechanismen erklären. Diese Wechselwirkung zwischen Beobachtungen und Theorie ist nicht linear, da die Entwicklung neuer Modelle zur Entdeckung neuer Muster führen kann, die wiederum neue Modelle inspirieren.
Die Methoden, mit denen Komplexitätsökonom*innen ihre Theorien und Musterbeobachtungen in wissenschaftlichen Zeitschriften kommunizieren, sind sehr vielfältig, aber im Allgemeinen recht formalistisch. Der Grund für die Beliebtheit dieses formalistischen Ansatzes ist, dass mathematische Modelle – wenn sie korrekt angewendet werden – eindeutig sind und interne Widersprüche einer Theorie sowie implizite Vorhersagen aufdecken.
Zur formalen Dokumentation von Mustern verwenden Komplexitätsökonom*innen eine Vielzahl theoretischer und empirischer Methoden. Empirische Forschung war ein wichtiger, wenn auch etwas fragmentierter Teil des Komplexitätsforschungsprogramms (Durlauf 2005). Eine umfangreiche Literatur hat sich mit der Dokumentation dieser Muster – auch als stilisierte Fakten (‚stylized facts‘) bekannt – beschäftigt. Diese stilisierten Fakten wurden mit einer Vielzahl von Methoden erhoben, darunter allgemeine ökonomische Methoden wie die Abbildung statistischer Momente (Cont 2001), moderne Ökonometrie (Angrist & Pischke 2017), maschinelles Lernen (Mullainathan & Spiess 2017), experimentelle Evidenz (Hommes et al. 2005) und Big-Data-Ansätze (Varian 2014), sowie Methoden der Komplexitätsökonomik wie die Identifizierung von Potenzgesetzen (Gabaix 2009) und die Untersuchung von Netzwerkstrukturen (Jackson 2008, 2014).
Zur Formalisierung von Theorien, die diese Muster erklären, verwenden Komplexitätsökonom*innen wiederum eine Vielzahl mathematischer Modellierungstechniken. Zu den beliebtesten Modellierungstechniken gehören Netzwerkmodellierung (Caldarelli et al. 2004), nichtlineare Dynamik (Bischi et al. 2017) und agentenbasierte Modellierung (ABM, ‚agent-based modelling‘) (Gallegati et al. 2017). Diese Modelltypen sind beliebt, weil sie Verhalten außerhalb des Gleichgewichts erfassen können und keine Annahmen über optimierende Akteure oder ökonomisches Gleichgewicht erfordern.
Die Wahl der geeigneten Modellierungsmethode hängt von den Mustern ab, die die Forscher erklären möchten, oder von den Vorhersagen, die sie treffen wollen. Allgemein wird die Methode bevorzugt, die Muster am besten beschreibt oder die besten Vorhersagen liefert. Wenn Modelle die gleiche Erklärungs- bzw. Vorhersagekraft haben, wird jeweils das einfachste (Sun et al. 2016) oder tiefgründigste (Gräbner 2017) Modell bevorzugt.
Um beispielsweise zentrale stilisierte Fakten der Finanzmärkte – wie stationäre Renditen, überschüssige Kurtosis und Volatilitätspersistenz (Cont 2011) – zu erklären, präsentieren Franke und Westerhoff (2012) ein einfaches dynamisches Systemmodell mit begrenzt rationalen Investoren, die zwischen trendfolgenden und fundamentalistischen Strategien wechseln, je nachdem, welche Strategie zu diesem Zeitpunkt profitabler ist. Seine Nicht-Gleichgewichts-Dynamik ermöglicht es, die Standard (konsumbasierten) Asset-Pricing-Modelle zu verbessern, die im Widerspruch zu diesen grundlegenden Fakten stehen (Adam et al. 2016). Dennoch zeigen Chiarella et al. (2009), dass eine rein agentenbasierte Methode überlegen ist, wenn man diese stilisierten Fakten zusammen mit mikroökonomischen Mustern erklären möchte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Komplexitätsökonom*innen eine sehr vielfältige Methodik und Modellvielfalt verwenden. Daher mag es schwerfallen, sie von anderen Ökonom*innen zu unterscheiden. Bei genauerer Betrachtung zeichnet sich die Methodik der Komplexitätsökonomik jedoch durch ihre Vielfalt an Modellen aus. Obwohl Modelle mit Gleichgewicht und rationalen Akteuren durchaus akzeptabel sind, sind sie nicht die Norm. Stattdessen ist es üblich, Modelle zu verwenden, die entweder die tiefgründigste Erklärung beobachteter Muster liefern oder die mit dem einfachsten Modell die besten Vorhersagen treffen.
6. Ideologie und politische Ziele
Komplexitätsökonom*innen streben danach, die Muster, die unser komplexes Wirtschaftssystem charakterisieren, besser zu verstehen. Gelegentlich führt dies zu dem Wunsch, durch Eingriffe Verbesserungen zu erzielen. Dies findet Anklang bei der politischen Linken und lässt sich mit der bereits erwähnten optimistischen Gruppe in Verbindung bringen. Andererseits kommen Komplexitätsökonom*innen manchmal zu der Erkenntnis, dass die Wirtschaft ein zu komplexes System ist, als dass Planung funktionieren könnte - im Gegenteil, Eingriffe könnten leicht nach hinten losgehen. Dies spricht eher die politische Rechte an und steht im Einklang mit der zuvor genannten bescheidenen Gruppe. Dennoch sind Komplexitätsökonom*innen heute sehr divers und lassen sich nicht leicht einer bestimmten Ideologie zuordnen - nicht einmal jene, die ich zuvor der optimistischen oder bescheidenen Gruppe zugeordnet habe.
7. Aktuelle Debatten und Analysen
Als neue Denkschule versuchen prominente Komplexitätsökonom*innen vor allem, andere Ökonom*innen davon zu überzeugen, ihre Analysen über rationales Erwartungsverhalten, repräsentative Akteure und Gleichgewichtsbetrachtungen hinaus auszuweiten. Dennoch gibt es einige interessante Debatten unter Komplexitätsökonom*innen. Dazu gehören: (1) die Abgrenzung zur Mainstream-Ökonomik, (2) die Rolle und Grenzen mathematischer Modelle, (3) das angemessene Maß an Modellkomplexität, (4) die Verwendung von Modellbeschreibungsprotokollen und (5) die Validierung von Modellen. Der nächste Abschnitt wird diese Debatten kurz beleuchten.
Erstens gibt es unter Komplexitätsökonom*innen Uneinigkeit über das Verhältnis der Komplexitätsökonomik zur Mainstream-Ökonomik. Eine Seite behauptet grundsätzlich, dass Komplexitätsökonomik ein völlig neues Feld ist, von dem die Mainstream-Ökonomik nur ein kleiner Teil ist, z.B. Arthur (2005), Farmer und Foley (2009). Die andere Seite sieht die Komplexitätsökonomik eher als Ergänzung zur konventionellen Ökonomik, die etwas über Musterbildung hinzufügt (Durlauf 2005).
Eine zweite Debatte betrifft die Bedeutung der Formalisierung von Theorien durch mathematische Modelle in der Komplexitätsökonomik. Dies ist weitgehend eine Debatte zwischen der Hayek-Tradition und den Ökonom*innen der optimistischen Tradition, die im Abschnitt zur Epistemologie beschrieben wurde.
Unter den Komplexitätsökonom*innen, die formale mathematische Modelle erstellen, gibt es eine Debatte darüber, wie komplex diese Modelle sein sollten. Generell wägen Modellierer zwischen zwei Regeln ab (Sun et al. 2016): "Keep It Simple Stupid" (KISS, Axelrod 1997) und "Keep It Descriptive Stupid" (KIDS, Edmonds & Moss 2004). Nach der ersten Regel sollte ein Modell so einfach wie möglich gehalten werden. Die zweite Regel argumentiert, dass das Modell das Zielsystem beschreiben sollte und nur dann vereinfacht werden sollte, wenn sich dies als gerechtfertigt erweist. Obwohl Komplexitätsmodelle hochkomplexe kognitive Akteure modellieren können (Sun 2006), erkennen Komplexitätsökonom*innen im Allgemeinen an, dass reale Menschen weitaus komplizierter sind, als es ihre Modelle zulassen.
Eine weitere Debatte wurde durch die Frustration über die Schwierigkeiten bei der Beschreibung und Reproduktion agentenbasierter Modelle angeregt. Angesichts des Fehlens eines Protokolls für die Beschreibung agentenbasierter Modellierungen entwickelten Grimm et al. (2010) das "Overview, Design and Details" (ODD)-Protokoll. Obwohl viele Modellierer es übernommen haben, insbesondere in der Ökologie, fehlt es in der Ökonomik nach wie vor an Einheitlichkeit bei der Beschreibung agentenbasierter Modelle, und es tauchen weiterhin neue Rahmenwerke und Ideen auf (siehe Gräbner 2018 für einen Überblick).
Schließlich gibt es als relativ neues Instrument noch keinen Konsens darüber, wie agentenbasierte Modelle validiert werden sollten (Fagiolo et al. 2007). Generell wird anerkannt, dass ABMs zur Validierung zumindest in der Lage sein sollten, einige zentrale stilisierten Fakten zu replizieren. Vorzugsweise sollten sie mehrere dieser Schlüsselmuster gleichzeitig replizieren können (Grimm et al. 2005). Doch Guerini und Moneta (2017) stellen fest, dass Modelle mit unterschiedlichen Kausalstrukturen dieselben stilisierten Fakten replizieren können. Sie schlagen daher eine Methode vor, die sich nur auf die Darstellung von Kausalstrukturen zwischen aggregierten Variablen des ABM konzentriert und testet, ob sie sich signifikant von den Kausalstrukturen unterscheiden, die in der realen Welt gefunden werden können. Ein anderer Ansatz in diesem Fall besteht darin, das Modell zu wählen, das auch mit niedrigeren (mikroökonomischen) stilisierten Fakten konsistent ist (Grimm et al. 2005). Mit anderen Worten: Nicht das einfachste Modell wird gewählt, sondern das Modell, das sowohl die beobachteten Phänomene sowie mehr der zugrunde liegenden Mechanismen erklärt (Gräbner 2017).
8. Abgrenzung: Unterschulen, andere ökonomische Theorien, andere Disziplinen
Indem sie die Wirtschaft als komplexes System betrachtet, unterscheidet sich die Komplexitätsökonomik insbesondere durch ihre Methodik sowie durch ihren erkenntnistheoretischen und ontologischen Fokus auf Komplexität. Dies macht sie mit den meisten anderen heterodoxen ökonomischen Denkschulen kompatibel, die mathematischer Modellierung nicht ablehnend gegenüberstehen, insbesondere der Österreichischen Schule, der Verhaltensökonomik, sowie der Ökologischen, der Evolutionären, der Institutionellen und der Postkeynesianischen Ökonomik. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Komplexitätsökonom*innen kognitive Regeln aus der Verhaltensökonomik, Neoklassik und Postkeynesianischen Ökonomik in einem evolutionären Rahmen verwenden. Da die Komplexitätsökonomik von der breiteren Komplexitätswissenschaft inspiriert wurde, zieht sie auch Inspiration aus anderen Disziplinen wie Biologie, Ökologie, Physik und Mathematik.
Aus Sicht der Komplexitätsökonomik konzentrieren sich Verhaltensökonomik, Ökologische, Evolutionäre und Institutionelle Ökonomik auf bestimmte Aspekte komplexer adaptiver Systeme. Verhaltensökonom*innen konzentrieren sich auf den Entscheidungsprozess der Akteure. Institutionenökonom*innen konzentrieren sich auf die Institutionen, die ihre Entscheidungen ermöglichen und prägen - dies ist hochgradig kompatibel mit der Komplexitätsökonomik (Gräbner und Kapeller 2015). Evolutionsökonom*innen untersuchen die Selektionsmechanismen, die sowohl Verhalten als auch Institutionen hervorbringen. Schließlich untersuchen Ökologische Ökonom*innen die Nachhaltigkeit des komplexen Systems und seine Beziehung zu anderen nicht-ökonomischen komplexen Systemen.
Die Österreichische Schule und die Postkeynesianische Ökonomik unterscheiden sich von diesen durch ihre breiteren Annahmen über das Wirtschaftssystem. Dennoch sind diese oft mit der Komplexitätsökonomik kompatibel.
Frühe Vertreter der Österreichischen Schule betrachteten die Wirtschaft bereits als komplexes adaptives System. Nach Veetil und White (2017): "Die Makroökonom*innen der Österreichischen Schule der Zwischenkriegszeit sahen die Wirtschaft als ein komplexes adaptives System, in dem makroökonomische Variablen aus der Interaktion zwischen Millionen von zielgerichtet handelnden Akteuren entstehen."[1] Darüber hinaus erklären Bowles, Kirman und Sethi (2017, S.215): "Friedrich Hayek ist bekannt für seine Vision der Marktwirtschaft als ein informationsverarbeitendes System, das durch spontane Ordnung gekennzeichnet ist: die Entstehung von Kohärenz durch die unabhängigen Handlungen einer großen Anzahl von Individuen, von denen jedes über begrenztes und lokales Wissen verfügt und das durch Preise koordiniert wird, die aus dezentralen Wettbewerbsprozessen entstehen." Schließlich betont das Neue Österreichische (auch Neo-Mengerianische) Paradigma die Bedeutung von Nicht-Gleichgewichts- und Emergenzprozessen bei der Erklärung der sozialen Welt (Salter 2017).
Ebenso betonen Postkeynesianer*innen fundamentale Unsicherheit, die Bedeutung von Institutionen, Entscheidungsheuristiken und Abweichungen vom Gleichgewicht in Form von Instabilität (Aboobaker, Köhler, Prante und Tarne 2016). Die charakteristische postkeynesianische Modellierungstechnik der Bestands-Fluss-Konsistenten Modellierung (‚Stock-Flow-Consistent Modelling‘) (Godley und Lavoie 2006) kann als Anwendung der Mathematik dynamischer Systeme auf die monetäre Makroökonomik verstanden werden. Zunehmend wird diese Technik mit agentenbasierter Modellierung kombiniert; siehe beispielsweise Seppecher (2012), Riccetti et al. (2015) und Caiani et al. (2016), Schasfoort et al. (2017).
Bleibe auf dem Laufenden!
Abboniere unser automatisches Content Newsletter, um keine neuen Beiträge mehr zu veerpassen! Außerdem kannst du den Newsletter des Netzwerk Plurale Ökonomik abbonieren.
Exploring Economics Plurale Ökonomik
9. Abgrenzung vom Mainstream
Die Komplexitätsökonomik wurde teilweise entwickelt, um dem vorherrschenden neoklassischen ökonomischen Paradigma entgegenzutreten. Sie unterscheidet sich in erster Linie von Mainstream-Ökonom*innen dadurch, dass sie Gleichgewicht und Optimierung nicht als Norm in der Ökonomik betrachtet, sondern als Spezialfall.
Bei der Betrachtung der Wirtschaft stützen sich Mainstream-Ökonom*innen stark auf das Konzept des Gleichgewichts. Der Hauptunterschied zwischen Komplexitätsökonomik und Mainstream liegt im Fokus auf Gleichgewichte - statische Muster, die keine weiteren Verhaltensanpassungen erfordern. Die Komplexitätsökonomik beschreibt die Wirtschaft hingegen nicht als deterministisch, hochgradig vorhersehbar und mechanistisch, sondern als pfadabhängig, organisch und ständig evolvierend (Arthur 1999). Dennoch wird die Gleichgewichtsökonomik nicht vollständig verworfen (Farmer & Geanakoplos 2009). Aus Sicht der Komplexitätsökonomik ist die Gleichgewichtsökonomik ein Spezialfall der Nicht-Gleichgewichtsökonomik und somit Teil der Komplexitätsökonomik (Arthur 2006).
Zudem waren Komplexitätsökonom*innen lautstarke Kritiker*innen der Mainstream-Hypothese der rationalen Erwartungen (Muth 1961). Diese geht davon aus, dass Wirtschaftsakteure das Modell der Wirtschaft kennen und im Durchschnitt seine Vorhersagen als gültig ansehen. Komplexitätsökonom*innen halten dies für so unrealistisch, dass dies die Ergebnisse von Mainstream-Modellen möglicherweise ungültig macht. In einigen Fällen sind Erwartungen selbstreferentiell: Wirtschaftliche Ergebnisse hängen von den Erwartungen der Akteure ab. Beispielsweise wenn Akteure entscheiden wollen, ob sie in eine Bar gehen oder nicht. Ihre Entscheidung, zu gehen, hängt von ihren Erwartungen darüber ab, wie voll die Bar ist. Wenn sie erwarten, dass sie voll ist, bleiben sie zu Hause und umgekehrt. Die Akteure erfahren erst am nächsten Tag, wie voll die Bar tatsächlich war - selbst wenn sie zu Hause geblieben sind. In diesem Fall wird sich kein Gleichgewicht der Bar-Besuche einstellen. Stattdessen wird es Schwankungen geben, da zwischen Erwartungen und Besuchen eine negative Beziehung besteht. In diesem Fall hilft die Annahme eines Gleichgewichts nicht nur weiter, sie würde auch die schwankende Besucherzahl nicht vorhersagen können. Dies ist Arthurs (1994) berühmtes El-Farol-Bar-Modell.
Angesichts der unterschiedlichen Schwerpunkte in Bezug auf das Gleichgewicht ist es nicht überraschend, dass Komplexitätsökonom*innen dazu neigen, Methoden der Nicht-Gleichgewichtsmodellierung zu verwenden. Darüber hinaus ist der methodische Ansatz der Komplexitätsökonom*innen induktiver Natur. Formale Modelle werden fast immer erstellt, um eine Reihe beobachteter Phänomene oder stilisierter Fakten zu erklären, die dann wiederum weitere empirische Arbeiten inspirieren können. Dies in der Mainstream-Ökonomik noch nicht immer der Fall, auch wenn sich das inzwischen ändert (Rodrik 2015).
10. Institutionen
Journals
Komplexitätsökonom*innen publizieren sowohl in "Mainstream"- als auch in "heterodoxen" Zeitschriften (Heise 2016). Die meisten Veröffentlichungen erscheinen in spezialisierten Zeitschriften wie:
- Advances in complex systems,
- Complexity,
- Computational economics,
- Journal for artificial societies and social simulation,
- Journal of economic dynamics and control
- Journal of economic behavior and organization,
- Journal of evolutionary economics,
- Quantitative finance.
Gelegentlich finden einige Komplexitätsökonom*innen den Weg in bekannte Mainstream-Zeitschriften wie: The American Economic Review (Arthur 1994, Colander et al. 2008), Econometrica (Hommes 1997), The Economic Journal (Arthur 1989, Durlauf 2005) und Journal of Economic Perspectives (Kirman 1992, Bowles et al. 2017). Schließlich haben einige Komplexitätsökonom*innen in renommierten allgemeinen Zeitschriften wie Science (Battiston et al. 2016) und Nature (Farmer and Foley 2009) publiziert.
Institute und Think tanks
Es gibt mehrere Thinktanks und Universitätsinstitute, die auf Komplexitätsökonomik spezialisiert sind. Die bekannteste davon ist das Santa Fé Institute. Zu den Universitätsinstituten, die aktiv an wirtschaftlicher Komplexität beteiligt sind, gehören:
- Institute for New Economic Thinking (INET) an der Oxford Martin School
- Institute of Complex Systems (ISC), Rome
- London School of Economics (LSE) Complexity Group.
- University of Amsterdam Center for Non-Linear Dynamics in Economics and Finance (CENDEF)
- University of Groningen Center for Social Complexity Studies (GCSCS)
- University of Michigan Center for the Study of Complex Systems
Literatur
Adam, K., Marcet, A. & Nicolini, J.P., 2016. Stock market volatility and learning. The Journal of Finance, 71(1), pp.33-82.
Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2017). Undergraduate econometrics instruction: through our classes, darkly. Journal of Economic Perspectives, 31(2), 125-44.
Arthur, W. B. (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. The economic journal, 99(394), 116-131.
Arthur, W. B. (1994). Inductive reasoning and bounded rationality. The American economic review, 84(2), 406-411.
Arthur, W. B. (1999). Complexity and the economy. Science, 284(5411), 107-109.
Arthur, W. B. (2006). Out-of-equilibrium economics and agent-based modeling. Handbook of computational economics, 2, 1551-1564.
Arthur, W. (2010). COMPLEXITY, THE SANTA FE APPROACH, AND NON-EQUILIBRIUM ECONOMICS. History of Economic Ideas, 18(2), 149-166. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/23723515
Arthur, W. B. (2013) Complexity Economics: A Different Framework for Economic Thought.
Armstrong, Angus (2017) Why Rebuild Macroeconomics?, https://www.rebuildingmacroeconomics.ac.uk/why-rebuild-macroeconomics/
Axelrod, R. M. (1997). The complexity of cooperation: Agent-based models of competition and collaboration. Princeton University Press.
Battiston, S., Farmer, J. D., Flache, A., Garlaschelli, D., Haldane, A. G., Heesterbeek, H., ... & Scheffer, M. (2016). Complexity theory and financial regulation. Science, 351(6275), 818-819.
Bischi, G.I., Dawid, H., Dieci, R. et al. J Evol Econ (2017) 27: 825. https://doi.org/10.1007/s00191-017-0533-5
Bosker, M., Brakman, S., Garretsen, H., & Schramm, M. (2007). Looking for multiple equilibria when geography matters: German city growth and the WWII shock. Journal of Urban Economics, 61(1), 152-169.
Bowles, Samuel, Alan Kirman, & Rajiv Sethi. 2017. "Retrospectives: Friedrich Hayek and the Market Algorithm." Journal of Economic Perspectives, 31(3): 215-30.
Brock, W. A., & Hommes, C. H. (1997). A rational route to randomness. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1059-1095.
Bunge, M. (1996). Finding Philosophy in Social Science. Yale University Press.
Caiani, A., Godin, A., Caverzasi, E., Gallegati, M., Kinsella, S. and Stiglitz, J.E., 2016. Agent based-stock flow consistent macroeconomics: Towards a benchmark model. Journal of Economic Dynamics and Control, 69, pp.375-408.
Caldarelli, G., Battiston, S., Garlaschelli, D., & Catanzaro, M. (2004). Emergence of complexity in financial networks. In Complex Networks (pp. 399-423). Springer, Berlin, Heidelberg.
Chiarella, C., Iori, G., & Perelló, J. (2009). The impact of heterogeneous trading rules on the limit order book and order flows. Journal of Economic Dynamics and Control, 33(3), 525-537.
Colander, D., Howitt, P., Kirman, A., Leijonhufvud, A., & Mehrling, P. (2008). Beyond DSGE models: toward an empirically based macroeconomics. The American Economic Review, 98(2), 236-240.
Commendatore P., Kubin I., Bougheas S., Kirman A., Kopel M., Bischi G.I. (2018) Introduction. In: Commendatore P., Kubin I., Bougheas S., Kirman A., Kopel M., Bischi G. (eds) The Economy as a Complex Spatial System. Springer Proceedings in Complexity. Springer, Cham
Cont, R. (2001) Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues, Quantitative Finance, 1:2, 223-236, DOI: 10.1080/713665670
Dopfer, K., Foster, J. & Potts, J. J. Evol. Econ. (2004) 14: 263. https://doi.org/10.1007/s00191-004-0193-0.
Durlauf, S. N. (2005). Complexity and empirical economics. The Economic Journal, 115(504).
Durlauf, S.N. (2012) "Complexity, economics, and public policy," Politics, Philosophy & Economics, , vol. 11(1), pages 45-75, February.
Edmonds, B., & Moss, S. (2004, July). From KISS to KIDS–an ‘anti-simplistic’modelling approach. In International Workshop on Multi-Agent Systems and Agent-Based Simulation (pp. 130-144). Springer Berlin Heidelberg.
Epstein, J. M. (2006). Generative social science: Studies in agent-based computational modeling. Princeton University Press.
Fagiolo, G., Moneta, A., & Windrum, P. (2007). A critical guide to empirical validation of agent-based models in economics: Methodologies, procedures, and open problems. Computational Economics, 30(3), 195-226.
Farmer, J. D., & Foley, D. (2009). The economy needs agent-based modelling. Nature, 460(7256), 685-686.
Farmer, J. D., & Geanakoplos, J. (2009). The virtues and vices of equilibrium and the future of financial economics. Complexity, 14(3), 11-38.
Gabaix, X. (2009). Power laws in economics and finance. Annu. Rev. Econ., 1(1), 255-294.
Gallegati, M., Palestrini, A., & Russo, A. (Eds.). (2017). Introduction to agent-based economics. Academic Press.
Gaus, G. F. (2007). Social complexity and evolved moral principles. In Liberalism, Conservatism, and Hayek’s Idea of Spontaneous Order (pp. 149-176). Palgrave Macmillan, New York.
Godley, W, & Lavoie, M (2006). Monetary economics: an integrated approach to credit, money, income, production and wealth. Springer.
Gräbner, C. (2017a). The complementary relationship between institutional and complexity economics: The example of deep mechanismic explanations. Journal of Economic Issues, 51(2), 392-400.
Gräbner, C. (2017b). How to relate models to reality? An epistemological framework for the validation and verification of computational models (No. 63). ICAE Working Paper Series.
Gräbner C., Kapeller J. (2015). New Perspectives on Institutionalist Pattern Modeling: Systemism, Complexity, and Agent-Based Modeling, Journal of Economic Issues, 49(2): 433–440. doi: 10.1080/00213624.2015.1042765.
Grimm, V., Revilla, E., Berger, U., Jeltsch, F., Mooij, W. M., Railsback, S. F. & DeAngelis, D. L. (2005). Pattern-oriented modeling of agent-based complex systems: lessons from ecology. science, 310(5750), 987-991.
Grimm, V., Berger, U., DeAngelis, D. L., Polhill, J. G., Giske, J., & Railsback, S. F. (2010). The ODD protocol: a review and first update. Ecological modelling, 221(23), 2760-2768.
Guerini, M. & Moneta, A. (2017) A method for agent-based models validation". In: Journal of Economic Dynamics and Control.
Haldane, A. G., & Turrell, A. E. (2018). An interdisciplinary model for macroeconomics. Oxford Review of Economic Policy, 34(1-2), 219-251.
Hayek, F. A. (1964). The theory of complex phenomena. The critical approach to science and philosophy, 332-349. Chicago
Heise, A. (2016). Whither economic complexity?.
Holling, C. S. (2001). Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems. Ecosystems, 4(5), 390-405.
Hommes, C. Sonnemans, J. Tuinstra, J. & van de Velden, H. (2005), Coordination of Expectations in Asset Pricing Experiments, The Review of Financial Studies, Volume 18, Issue 3, 1 October, Pages 955–980, https://doi.org/10.1093/rfs/hhi003.
Hoogduin, L. (2016). New approaches to economic challenges: insights into complexity and policy. OECD, pp.11-13.
Jackson M (2008) Social and Economic Networks. New York: Oxford University Press.
Jackson, M. O. (2014). Networks in the understanding of economic behaviors. Journal of Economic Perspectives, 28(4), 3-22.
Jager, W. (2000). Modelling consumer behaviour s.n.
Jager, W., Janssen, M.A., De Vries, H.J.M., De Greef, J. & Vlek, C.A.J., 2000. Behaviour in commons dilemmas: Homo economicus and Homo psychologicus in an ecological-economic model. Ecological economics, 35(3), pp.357-379.
Keynes, J.M. (1921), A Treatise on Probability, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. VIII, London.
Keynes, J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. VII, London, v.a. Kapitel 12.
Keynes, J.M. (1937), “The General Theory of Employment”, reprinted in The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. XIV, pp. 109-124.
Kirman, A.P., 1992. Whom or what does the representative individual represent?. The Journal of Economic Perspectives, 6(2), pp.117-136.
Kirman, A. (2006). Heterogeneity in economics. Journal of Economic Interaction and Coordination, 1(1), 89-117.
Kirman A., 2016, Complexity and economic policy,http://oecdinsights.org/2016/08/29/complexity-and-economic-policy/
Kirman, A. (2017). The economy as a complex system. In Economic Foundations for Social Complexity Science (pp. 1-16). Springer, Singapore.
Knight, F. H. (1921): Risk, Uncertainty and Profit. Boston: Houghton Mifflin.
Lo, A.W., 2004. The adaptive markets hypothesis. The Journal of Portfolio Management, 30(5), pp.15-29.
Li, T.Y. and Yorke, J.A., 1975. Period three implies chaos. The American Mathematical Monthly, 82(10), pp.985-992.
Lindgren, K. (1997). Evolutionary dynamics in game-theoretic models. In The economy as an evolving complex system II (pp. 337-368).
Mullainathan, S., & Spiess, J. (2017). Machine learning: an applied econometric approach. Journal of Economic Perspectives, 31(2), 87-106.
Muth, J.F. (1961) "Rational Expectations and the Theory of Price Movements" reprinted in The new classical macroeconomics. Volume 1. (1992): 3–23 (International Library of Critical Writings in Economics, vol. 19. Aldershot, UK: Elgar.).
Franke, R. & Westerhoff, F. (2012). Structural stochastic volatility in asset pricing dynamics: Estimation and model contest. Journal of Economic Dynamcis and Control, 36:1193–1211.
Riccetti, L., Russo, A., & Gallegati, M. (2015). An agent based decentralized matching macroeconomic model. Journal of Economic Interaction and Coordination, 10(2), 305-332.
Rodrik, D. (2015). Economics rules: The rights and wrongs of the dismal science. WW Norton & Company.
Salter, A.W. Rev Austrian Econ (2017) 30: 39. doi:10.1007/s11138-016-0350-3.
Schasfoort, J., Godin, A., Bezemer, D., Caiani, A., & Kinsella, S. (2017). Monetary Policy Transmission in a Macroeconomic Agent-Based Model. Advances in Complex Systems, 20(08), 1850003.
Seppecher, P. (2012). Flexibility of wages and macroeconomic instability in an agent-based computational model with endogenous money. Macroeconomic Dynamics, 16(S2), 284-297.
Simon, H.A., (1972). Theories of bounded rationality. Decision and organization, 1(1), pp.161-176.
Simon, H. A. (1991). Bounded rationality and organizational learning. Organization science, 2(1), 125-134.
Sun, R. (2006). Prolegomena to integrating cognitive modeling and social simulation. Cognition and multi-agent interaction: from cognitive modeling to social simulation, 3-26.
Sun, Z., Lorscheid, I., Millington, J. D., Lauf, S., Magliocca, N. R., Groeneveld, J. & Buchmann, C. M. (2016). Simple or complicated agent-based models? A complicated issue. Environmental Modelling & Software, 86, 56-67.
Varian, H. R. (2014). Big data: New tricks for econometrics. Journal of Economic Perspectives, 28(2), 3-28.
Veetil, V.P. & White, L.H. Rev Austrian Econ (2017) 30: 19. doi:10.1007/s11138-016-0354-z
Wren-Lewis, S. (2014), Conditional and unconditional forecasting, https://mainlymacro.blogspot.co.za/2014/08/conditional-and-unconditional.html.
[1] Englische Originalzitat wurden von uns ins Deutsche übersetzt.
Zugewiesene Kursmodule
| Titel | Dozent*in | Anbieter | Start | Level |
|---|---|---|---|---|
| Thinking Complexity | Cameron Guthrie | Toulouse Business School | flexibel | leicht |
| Complexity Economics | Think Academy | - | flexibel | mittel |
| Emergence Theory | Think Academy | - | flexibel | leicht |
| Introduction to Complexity | Melanie Mitchell | Santa Fe Institute | immer | leicht |
| Eine Einführung in Agentenbasierte Modellierung mit Python | Dr. Claudius Gräbner | n.a. | immer | mittel |
| Makroökonomische Modelle - Ein multiparadigmatischer Überblick | Claudius Gräbner | University of Duisburg-Essen | immer | mittel |
| Introduction to Complexity | Melanie Mitchel, Santiago Guisasola | Santa Fe Institute | immer | mittel |
| Game Theory I - Static Games | Justin Grana | Santa Fe Institute | immer | mittel |
Organisationen und Links
Complexity Explorer
https://www.complexityexplorer.org/
Santa Fe Institute
https://www.santafe.edu/about