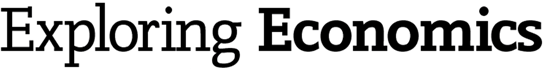Die vergessene Alternative
agora42, 2025
Dieser Text ist eine Zweitveröffentlichung desselben Texts in der Ausgabe 4/2025 - "WAS IST DER PLAN?" der Zeitschrift "agora42", veröffentlicht am 15. Oktober 2025 - s.https://agora42.de/was-ist-der-plan-editorial-zur-ausgabe-4-2025/
Die vergessene Alternative
Die Debatte um die Planwirtschaft
Lange galt die Planungswirtschaft als historisch erledigt. Angesichts multipler Krisen erlebt der Ansatz nun aber eine überraschende Renaissance.
„Jeder Schritt weg vom Privateigentum an den Produktionsmitteln ist auch ein Schritt weg von der rationalen Wirtschaft“ – so begann der österreichische Ökonom Ludwig von Mises (1881–1973) die „Socialist Calculation Debate“ (zu deutsch etwa „Debatte um die Wirtschaftsrechnung im Sozialismus“)1. Seine Schrift "Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen" von 1920, aus der dieser Satz stammt, war eine Replik auf den Vorschlag einer geldlosen Wirtschaftsrechnung, die der ebenfalls aus Österreich stammende Ökonom Otto Neurath (1882–1945) aufbauend auf den Erfahrungen der Kriegswirtschaft formuliert hatte.
Nach dem Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution in Russland gewannen ökonomische Alternativen zur Marktwirtschaft enorm an politischer und intellektueller Anziehungskraft. Viele Ökonomen hielten eine planwirtschaftliche Organisation der Wirtschaft für nicht nur wünschenswert, sondern auch für machbar. Mises‘ Ziel war es hingegen, einen scheinbar unüberwindlichen, logischen Einwand vorzubringen. Er argumentierte, dass eine komplexe, moderne Industriegesellschaft ohne Privateigentum an Produktionsmitteln und ohne die daraus entstehenden Marktpreise keine rationale Wirtschaftsrechnung durchführen könne. Ohne Preise, die Knappheit widerspiegeln, gäbe es für Planer keine Möglichkeit, Kosten zu kalkulieren, Ressourcen effizient zuzuteilen oder zwischen unzähligen Produktionsmöglichkeiten rational zu entscheiden. Sein Essay war also eine radikale Absage an die Möglichkeit des Sozialismus auf theoretischer Ebene und sollte ihm die intellektuellen Grundlagen entziehen, um seine politische Umsetzung zu verhindern.
Ein Schüler von Ludwig Mises, Friedrich August von Hayek (1899–1992), führte die Debatte weiter. Hayek, der als ein zentraler intellektueller Wegbereiter des späteren Neoliberalismus gilt, machte vor allem ein wissenstheoretisches Argument. Wissen – etwa über Bedürfnisse, Ressourcen oder Produktionsmöglichkeiten – ist dezentral in der Gesellschaft verteilt und kann daher nicht zentral gesammelt und verarbeitet werden. Märkte wären daher der notwendige Mechanismus, um dieses Wissen – vermittelt durch Preise – gesellschaftlich zu verbreiten.
Planung – selbstverständlich!
Dass sich Ökonomen damals genötigt sahen, sich gegen zu starke Staatsintervention oder gar „Sozialismus“ zur wehr zu setzen, ist aus heutiger Perspektive schwer nachzuvollziehen. Doch Planung war über lange Zeit ein wichtiger Gegenstand des ökonomischen Denkens und spielte auch in der wirtschaftspolitischen Praxis eine wichtige Rolle. Bereits der Merkantilismus des 16. und 17. Jahrhunderts war eine Frühform staatlicher Wirtschaftsplanung. Außenhandelslenkung, Subventionierung, Zölle – was heute gerne als große Neuerung angesehen wird, war damals das herrschende Paradigma.
Merkantilismus: Als Merkantilismus wird das vorherrschende Wirtschaftssystem in Westeuropa von circa 1600 bis 1750 bezeichnet. Der Merkantilismus legt das Hauptgewicht auf die Förderung des Außenhandels (etwa durch die Gründung privilegierter Transportgesellschaften oder Großbetriebe). Dadurch soll Geld ins Land fließen. Zugleich stellt er eine frühe Form des Protektionismus dar, also eine Außenhandelspolitik, die zum Beispiel durch Schutzzölle, Handelshemmnisse oder Einfuhrsteuern die inländischen Produzenten gegen ausländische Konkurrenz absichern möchte.
Im 18. und 19. Jahrhundert setzte sich dann zwar das marktliberale Wirtschaftsdenken durch – Adam Smiths „unsichtbare Hand des Marktes“ lässt grüßen – doch staatliche Planungselemente blieben zentral, etwa in der Infrastruktur-, Außenhandels-, Kriegs- und Kolonialpolitik. Die neoklassischen Gründerväter Léon Walras (1834–1910) und Vilfredo Pareto (1848–1923) – obwohl Befürworter von Märkten – hielten es Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts prinzipiell für möglich, die von ihnen aufgestellten Gleichungssysteme durch zentrale Kalkulation (bzw. Planung) zu lösen. Als aus dieser theoretischen Option mit der russischen Revolution und weiteren revolutionären Bestrebungen eine politische Praxis zu werden schien, war der Kontext für die historische „Socialist Calculation Debate“ gesetzt. Liberale Ökonomen dieser Zeit mussten sich, auch wenn sie sich nicht direkt an der Debatte beteiligten, mit dem Planungsansatz auseinandersetzen.
Die zentrale Rolle des Staatsinterventionismus
Ein gutes Beispiel hierfür ist der Ökonom Joseph Schumpeter (1883–1950), der in Harvard lehrte. In seinem Hauptwerk Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie (1942) führt er auf vielfältige Weise aus, dass der Sozialismus als geplantes Wirtschaftssystem prinzipiell effizient organisiert werden könnte – sogar effizienter als Marktsysteme. Auch wenn er letztere aufgrund ihrer Innovationskraft befürwortete, teilte er nicht Mises’ strikte Argumentation, wonach eine rationale Wirtschaft ohne Privateigentum und freie Märkte unmöglich wäre. Paul Samuelson (1915–2009), ein über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts führender Ökonom, schrieb bis 1976 in seinem Standart-Lehrbuch Economics: An Introductory Analysis, dass „eine sozialistische Planwirtschaft funktionieren und sogar florieren kann“.
Diese Zugeständnisse an planwirtschaftliches Denken und den (realexistierenden) Sozialismus sind im Kontext des weit verbreiteten Staatsinterventionismus der damaligen Zeit zu verstehen. Die Erfahrung der Kriegsplanung im Zweiten Weltkrieg, die keynesianische Fiskalpolitik und die Entwicklungsplanung als Kernstrategie für die „Dritte Welt“ verdichteten sich in zu einem Wirtschaftsparadigma, in dem staatlicher Wirtschaftsplanung neben Märkten eine zentrale Rolle zugeschrieben wurde. Auch wenn die sowjetische Planwirtschaft der politische Gegner war, waren Formen von Planung auch in der „ersten“ und „dritten“ Welt weit verbreitet.
Niedergang und Rückkehr des Staatsinterventionismus
Das Planungsparadigma erlebte seinen Niedergang zwischen den 1970er und 1990er Jahren. Die Stagflation im Westen ab 1973 und das Scheitern keynesianischer Steuerung, die Schuldenkrisen des Globalen Südens ab 1982 mit nachfolgenden Strukturanpassungsprogrammen und schließlich der Zusammenbruch der UdSSR (1989–1991) schienen empirische Belege für die Überlegenheit der Märkte zu liefern. Der Glaube an diese Überlegenheit dominierte in der folgenden Zeit die Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspolitik.
Doch die Markteuphorie bekam spätestens seit der großen Finanzkrise von 2008 deutliche Risse. Während Wirtschaftskrisen die inhärenten Probleme und die Instabilität des Finanzkapitalismus aufzeigten, beschleunigte sich zugleich die ökologische Krisendynamik (inklusive der Covid19 Pandemie). Zudem führte massive Kapitalkonzentration die Möglichkeit effizienter Wirtschaftsplanung, wie sie innerhalb transnationaler Konzerne stattfindet, eindrucksvoll vor Augen, wie Phillips und Michal Rozworski in The People's Republic of Walmart (2019) dargelegt haben. Auch die rapiden technologischen Entwicklungen warfen die Frage auf, ob Big Data, künstliche Intelligenz und Feedback-Technologien eine neue Form der makroökonomischen Koordination ermöglichen können.
Zentral für die Wiederkehr des Staatsinterventionismus ist jedoch – wie schon in früheren Phasen der Wirtschaftsgeschichte – die zunehmende geopolitische Konkurrenz zwischen kapitalistischen Großmächten. Vor dem Hintergrund der genannten Entwicklungen – Kapitalkonzentration, ökologische Krise, technologische Umbrüche und ökonomische Instabilität – verändert sich die Rolle des Staates, der immer stärker eingreift, um wirtschaftliches Wachstum aufrechtzuerhalten und nationale ökonomische Interessen zu verteidigen.
Der „Neue Staatsinterventionismus“ ist kein einheitliches Paradigma und noch nicht festgelegt. Er kann auf der einen Seite in eine autoritäre Richtung kippen, bei der kapitalistische Ungleichheit mit illiberalen politischen Strukturen abgesichert wird. Genauso gibt es aber andererseits liberal-reformistische Ansätze, die den Kapitalismus, wie einst Keynes, „vor sich selber retten“ und zu diesem Zweck stark reformieren wollen. Anknüpfend an diesen liberal-reformistischen Strang finden sich stärker sozialdemokratische und (öko-)sozialistische Positionen, die im herrschenden Diskurs oft noch zu kurz kommen, und sich beispielhaft in der Forderung nach „ökologischer Planung“ des Front Populaire in Frankreich wiederfinden.
Socialist Calculation Debate 2.0
Vor dem Hintergrund des neuen Staatsinterventionismus erlebt auch die akademische Planungsdebatte seit einigen Jahren eine unerwartete Renaissance. Sie baut dabei auf Modellen auf, die sich sowohl gegen den sogenannten „Marktsozialialismus“ wendeten – der vor allem als theoretischer Strang, in Jugoslawien jedoch auch als realpolitische Modell existierte – als auch gegen die autoritäre Kommandowirtschaft der Sowjetunion. Die fortgeschrittenen Modelle versuchen die Aufteilung in „zentral“ (Staat) einerseits und „dezentral“ (Markt) andererseits zu überwinden, die sich durch die vergangenen Debatten zieht. Sie setzen auf hybride Strukturen, in denen einzelne Wirtschaftseinheiten bzw. Unternehmen weiterhin eigenständig planen, Preise festlegen und auf Märkten interagieren können. So wie in kapitalistischen Ökonomien Planungsmechanismen existieren, können auch in postkapitalistischen Modellen Marktmechanismen vorkommen – jedoch in gesellschaftlich eingebetteter Form, sodass sie nicht destruktiv wirken. Dadurch soll lokales Wissen der einzelnen ökonomischen Einheiten nutzbar gemacht werden, ohne dass das Gesamtsystem durch das Profitstreben der Unternehmen und Marktdynamiken dominiert wird. Im Modell des britischen Ökonomen Pat Devine wird in diesem Zusammenhang beispielsweise davon gesprochen, dass Marktbeziehungen zwar bestehen bleiben können, Marktkräfte jedoch überwunden werden müssen. Zentrales Werkzeug hierzu ist die demokratische Koordinierung größerer, gesellschaftlich relevanter Investitionsentscheidungen.
Durch die hybride zentral-dezentrale Wirtschaftsstruktur ist Hayeks wissenstheoretische Kritik in der neueren Planungsdebatte mitgedacht. Das „Informationsproblem“ – also die Frage, wie sich dezentral verteilte Informationen über Bedürfnisse, Ressourcen und Produktionsmöglichkeiten erfassen und verarbeiten lassen – versuchen moderne Planungsmodelle durch dezentrale Koordinations- und Feedbackmechanismen aufzulösen.
Die Modelle und Kontroversen der „Neuen Planungsdebatte“ sind vielfältig. Jan Groos und Christoph Sorg unterscheiden in Ihrem Buch Creative Construction: Democratic Planning in the 21st Century and Beyond (2025) drei Stränge in der zeitgenössischen Planungsdebatte. Ein erster Strang untersucht die expandierende Planung im Kapitalismus – sowohl in Form interner Unternehmensplanung in transnationalen Konzernen als auch in Gestalt des neuen Staatskapitalismus, der massiv in Märkte eingreift. Ein zweiter Strang untersucht, wie neue Technologien eine dezentrale, demokratische Koordination ermöglichen könnten, etwa durch Plattformen und Feedbackmechanismen. Ein dritter Strang schließt an die Postwachstums-Debatte an und geht teilweise in sie über, und untersucht die Möglichkeiten ökologischer Planung im Kontext der Klimakrise.
Zentrale (akademische) Akteure der Planungsdebatte haben zudem das „International Network for Democratic Economic Planning“ (INDEP – www.indep.network/) gegründet, eine Plattform, auf der Informationen geteilt, Debatten geführt und Projekte gemeinsam entwickelt werden. In Deutschland organisiert das „Netzwerk Demokratische Wirtschaftsplanung“ jährliche Konferenzen und Publikationen (www.demokratische-planung.de/info/ueber-uns/).
Die Debatte steht erst am Anfang
Die „Socialist Calculation Debate 2.0“ speist sich vor allem aus der kritischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaft und spielt sich bisher noch primär in akademischen Netzwerken und populärwissenschaftlichen Publikationsmedien ab. Den wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream hat sie noch nicht erreicht. Während die historische „Socialist Calculation Debate“ in zentralen Fachzeitschriften behandelt wurde und die gesamte ökonomische Zunft von ihr mitbekam, werden in den VWL-Vorlesungen noch immer Marktgleichgewichte und Pareto-Optimalität gepredigt. Auch die „Plurale Ökonomik“ als wichtigster Herausforderer der Mainstream-VWL hat den neuen Planungsansatz noch nicht in sich aufgenommen.
Im gesamtgesellschaftlichen ökonomischen Diskurs sieht es kaum anders aus. Der „Neue Staatsinterventionismus“ und die „Neue Planungsdebatte“ sind zwar gleichermaßen Ausdruck eines größeren paradigmatischen Wandels, der Alternativen zu Märkten als zentralem ökonomischen Koordinations- und Steuerungsinstrument sucht. Doch auf die realpolitischen Diskussionen, die sich um nationale Industrie- und Infrastrukturpolitik, Aufrüstung und geopolitischer Konkurrenz drehen, hat der Planungsdiskurs noch wenig Einfluss. Dazu fehlt die Übersetzung des Planungsansatzes – der ja Wirtschaftsdemokratie, ökologische Nachhaltigkeit und internationale Kooperation in den Mittelpunkt stellt – in konkrete wirtschaftspolitische Leitlinien und Instrumente. Es wäre noch konkreter auszuarbeiten, wie in Bezug auf Preiskontrollen, Investitionslenkung, öffentliches Eigentum und Transformationsräte eine demokratische und ökologische Wirtschaftsplanung umgesetzt werden könnte. Dabei geht es sowohl um konkrete Transformationspläne innerhalb einzelner Sektoren – etwa den Umbau des Energiesystems – als auch um Planungsmechanismen, die auf gesamtwirtschaftlicher Ebene notwendig sind und die ökonomische Planung mit den Mechanismen der parlamentarischen Demokratie und neuen demokratischen Instrumenten verknüpfen. Um diese theoretischen und politischen Brücken zu schlagen, sind breite Kooperationen notwendig, die über die Wissenschaft hinaus in die Zivilgesellschaft, Medien und (Partei-)Politik hineinreichen.
[1] Die historische Darstellung der Socialist Calculation Debate orientiert sich stark an der Veröffentlichung von Christoph Sorg & Jan Groos: Rethinking economic planning. Competition & Change, Band 29 (1).
Samuel Decker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Netzwerk Plurale Ökonomik e.V. und engagiert sich zudem im Netzwerk Demokratische Wirtschaftsplanung. Von ihm zum Thema erschienen:
Decker, S. (2025). The Question of Transformation – Approaches to Economic Planning in Existing Policy Proposals. In: Sorg, C., Groos, J., (Hg.): Creative Construction: Democratic Planning in the 21st Century. Bristol.
Decker, S. (2024). Planung und Transformation. PROKLA. Zeitschrift für Kritische Sozialwissenschaft, 54(215), 289–299.
Decker, S. (2024, Mai). Comeback der Planung? Staatsinterventionen für das Kapital. LUXEMBURG – Gesellschaftsanalyse und linke Praxis, (Mai 2024). Abgerufen von https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/comeback-der-planung/.
Decker, Samuel (2021). Mit dem Grundgesetz in den Sozialismus? (21.5.2021). URL: https://jacobin.de/artikel/grundgesetz-sozialismus-artikel-15-vergesellschaftung-enteignung-abendroth-planwirtschaft-daniel-e-saros.
Vom Autor empfohlen:
Christoph Sorg, Jan Groos: Creative Construction: Democratic Planning in the 21st Century and Beyond (Bristol University Press, 2025) - Dieser Sammelband gibt den aktuellen Stand der akademischen Debatte wieder.
Hahnel R (2021) Democratic Economic Planning. London: Routledge. - Entwickelt das partizipativer Planung als Alternative zu Markt und Zentralplanung.
Devine P (1988) Democracy and Economic Planning: The Political Economy of a Self-Governing Society. Cambridge: Polity Press. - Ein klassiker der modernen Planungsdebatte – entwickelt das Modell der “ausgehandelten Koordination”
Phillips, L., & Rozworski, M. (2019). The People’s Republic of Walmart: How the world’s biggest corporations are laying the foundation for socialism. Verso. - Zeigt, dass Großkonzerne wie Walmart bereits als gigantische Planwirtschaften agieren und stellt die Frage nach deren Demokratisierung.
Blakeley, G. (2025). Die Geburt der Freiheit aus dem Geist des Sozialismus: Wie das Kapital die Demokratie zerstört. (C. A. Herschmann, A. Krützfeldt & T. Müller, Übers.). Stuttgart: Tropen. - Zeigt, dass der Kapitalismus schon immer eine Form hegemonialer Planung war – und Freiheit nur durch demokratische und sozialistische Gegenmacht möglich wird.