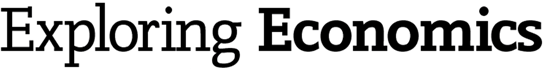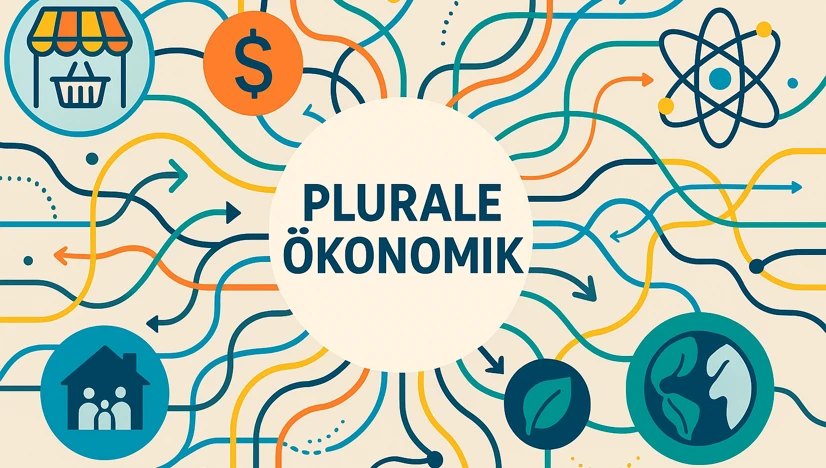Plurale Ökonomik
Exploring Economics
Einführung: Wie kommt ein Mensch zu einem Brot?
Man kann es im Supermarkt kaufen. Oder beim Bäcker um die Ecke. Vielleicht ist das ein alter Familienbetrieb oder ein junges Start-Up? Man kann es selbst backen, aus einer hundert Jahre alten Sauerteigkultur, mit lokal gemahlenem Getreide. Man kann es geschenkt bekommen. Vielleicht wird es subventioniert, etwa in Schulen oder durch Sozialprogramme. An manchen Orten wird es durch eine solidarische Landwirtschaft erzeugt und in Krisenzeiten wird es vielleicht durch den Staat rationiert.
In jedem dieser Fälle wird ein Bedürfnis gedeckt aber auf ganz unterschiedliche Weise.Nicht nur das Brot ist anders, auch die sozialen Rollen, die Preisbildung, ökologischen Effekte, die vermittelnden Institutionen und dahinter liegende Infrastrukturen. Was hier als „normal“ gilt, wirkt woanders befremdlich. Was hier funktioniert, scheitert anderswo. Und was heute selbstverständlich scheint, war vor wenigen Jahrzehnten noch ungewohnt. Die Vielfalt wie Menschen sich versorgen, handeln, teilen, tauschen, investieren, aufbauen, umbauen oder kurz wirtschaften ist kein Randphänomen. Sie prägt unseren Alltag ebenso wie die globale Wirtschaft. Sie ist Ausdruck kultureller Gewordenheit, institutioneller Rahmung, eingespielter Mechanismen und nicht zuletzt individueller und kollektiver Freiheit.
Plurale Ökonomie bezeichnet diese gelebte Vielfalt, die tatsächliche Bandbreite wirtschaftlicher Formen, Praktiken und Institutionen in Geschichte und Gegenwart.
Plurale Ökonomik ist die Wissenschaft, die sich dieser Vielfalt systematisch widmet. Sie untersucht, vergleicht und reflektiert die unterschiedlichen Wege des Wirtschaftens und schafft so ein reflexives Orientierungswissen.
Auf diese Weise wird Plurale Ökonomik in diesem Text als reflexiver disziplinärer Rahmen eingeführt, der es ermöglicht, die Vielfalt ökonomischer Praxis ebenso wie ökonomischer Forschung sichtbar, vergleichbar und gestaltbar zu machen. Denn wer verstehen will, wie Wirtschaft funktioniert und wie sie gestaltet werden kann, muss sich in ihrer Vielfalt zurechtfinden können. Dabei wird auch auf bisherige Verwendungen des Begriffs Plurale Ökonomik eingegangen, etwa als Selbstbeschreibung einer sozialen Bewegung oder als umkämpfter Sammelbegriff bestimmter wirtschaftswissenschaftlicher Ansätze.
Plurale Ökonomie: Die Wege des Wirtschaftens
Plurale Ökonomie (griech. polloí «viele», oîkos «Haus, Haushalt», nómos «Ordnung», -ía «Technik, Praxis, Kunst») bezeichnet die Vielfalt der Formen des Wirtschaftens, der Techniken, Praktiken und Ordnungen, mit denen Menschen mit Knappheit umgehen, bzw. ihre Versorgung organisieren und Wohlstand kultivieren. Dabei geht es nicht nur um verschiedene Systeme oder Länder, sondern um unterschiedliche Weisen des Wirtschaftens, Wirtschaftsstile, innerhalb und zwischen Gesellschaften. Denn nicht nur Brot, sondern alle Ressourcen können auf sehr verschiedene Weisen bereitgestellt werden, wie ein zweites Beispiel vertieft illustriert.
Beispiel: Wohnraum
Wie ein Haus bewirtschaftet wird, hängt davon ab welchen Rahmen man wählt:
- Als Kapitalanlage wird Wohnraum vor allem unter dem Aspekt von Rentabilität betrachtet. Investitionen sollen sich lohnen, Mieten sichern Einnahmen, Sanierungen erhöhen den Marktwert. Diese Perspektive kann zur effizienten Nutzung knapper Flächen führen etwa durch zügige Projektentwicklung oder Modernisierung. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass soziale Aspekte wie Erschwinglichkeit oder Nachbarschaftsbindung in den Hintergrund treten oder sogar Leerstand in Kauf genommen wird, um zu spekulieren.
- Als Gemeingut in einer Genossenschaft steht häufig die langfristige Versorgungssicherheit im Mittelpunkt. Mieten orientieren sich an tatsächlichen Kosten weitgehend ohne Renditedruck. Entscheidungen werden ggf. kollektiv getroffen. Das kann eine stabile, solidarische Wohnform ermöglichen, birgt aber auch Herausforderungen, etwa bei Investitionen oder bei der Lösung von Konflikten.
- Als Teil staatlicher Daseinsvorsorge wird Wohnraum über Bauprogramme, Förderinstrumente oder Preisbindungen gestaltet. Der Staat kann gezielt eingreifen, um soziale Ziele zu erreichen etwa in Krisenzeiten, bei besonderem Bedarf oder um räumliche Segregation zu verhindern. Gleichzeitig muss er dabei politische, fiskalische und verwaltungstechnische Zwänge abwägen.
- Als persönliches Projekt etwa in Form eines selbstgebauten Hauses oder gemeinschaftlichen Wohnprojekts kann Wohnen auch Ausdruck individueller Lebensgestaltung, familiärer Selbstversorgung, Altersvorsorge oder alternativer Lebensformen sein.
In all diesen Fällen geht es um „Wohnen“. Doch je nachdem, wie dieses Grundbedürfnis wirtschaftlich organisiert wird, verändern sich nicht nur Bauweise, Finanzierung oder Mietpreis, sondern auch zentrale Begriffe, Rollen und Zielwerte. Diese unterschiedlichen Wege des Wirtschaftens lassen sich auch als unterschiedliche wirtschaftliche Stile verstehen. In der Realität haben wir es häufig mit Mischformen zu tun. In Singapur zum Beispiel baut das staatliche «Housing Development Board» Eigentumswohnungen. Jeder Singapurer kann eine Wohnung zu subventionierten Preisen erwerben. Nach einer gewissen Zeit werden die Wohnungen frei gehandelt.
Diese Vielfalt wirtschaftlicher Formen stellt nicht nur eine empirische Realität dar, sie ist auch eine Herausforderung für die ökonomische Theorie. Plurale Ökonomik nimmt sich dieser Herausforderung als disziplinärer Rahmen an.
Plurale Ökonomik als Reflexionsrahmen
Plurale Ökonomik als wissenschaftliche Disziplin analysiert die verschiedenen Normen des Wirtschaftens systematisch, nicht bewertend, sondern vergleichend. Sie fragt: Was sind die Voraussetzungen, Funktionen, Wirkungen, Kontexte und Gestaltungsmöglichkeiten verschiedener ökonomischer Stile?
Dabei drückt der Begriff Plurale Ökonomik einen Wandel aus, der sich in der ökonomischen Forschung seit den 1980er Jahren abzeichnet. Statt rein theoretisch zu zeigen, dass Märkte effizient sind, wird heute untersucht unter welchen Bedingungen sie funktionieren und wann sie versagen. Wann Gemeingüter, bzw. die Commons zu einer Tragödie führen und wann sie gelingen, oder wann die öffentliche Zuteilung von Plätzen an Schulen, Organspenden oder Lebensmittelhilfen effektiv von Verwaltungen organisiert wird und wann nicht. Somit geht es zunehmend nicht mehr nur um die Funktion der Wirtschaft im Singular, sondern die verschiedenen Wirtschaftsweisen in ihren konkreten Kontexten.
Der Nobelpreisträger Jean Tirole drückt diesen Wandel durch die Wendung aus: «Der Fuchs weiß viele Dinge, aber der Igel weiß eine große Sache.» Ökonomen sind früher häufig wie Igel vorgegangen. Sie orientierten sich an einem großen Prinzip, etwa der Idee des vollkommenen Marktes und leiteten daraus universelle Aussagen ab. Heute arbeiteten Ökonomen ihm zufolge viel eher wie Füchse. Sie nutzen unterschiedliche Modelle, berücksichtigen verschiedene Kontexte und wählen ihre Werkzeuge gezielt je nach Problemstellung (2017).
Plurale Ökonomik führt diesen Wandel weiter, indem sie ihn methodologisch rahmt. Denn während die Wirtschaftswissenschaften in vielen Bereichen kontextbezogener, empirisch differenzierter und methodisch vielfältiger geworden sind, bleibt der erweiterte disziplinäre Rahmen oft implizit. Modelle werden pragmatisch genutzt, aber selten in ihren Grundannahmen verglichen. Normative Fragen tauchen auf, aber ohne systematische Reflexion. Plurale Ökonomik schafft einen methodologischen Rahmen, in dem sich die ganze Breite ökonomischer Forschung abbilden lässt, von etablierten Modellen bis zu alternativen Ansätzen.
Konkret liefern zum Beispiel viele klassische ökonomische Modelle hilfreiche theoretische Folien für den Bereich monetären Wirtschaftens, die Spieltheorie für strategische Interaktionen, die feministische Ökonomik für die nicht monetär organisierte Care-Ökonomie. Der Diskurs zu den Commons behandelt gemeinschaftlich orientierte Wirtschaftsweisen und die ökologische Ökonomik hilft die planetaren Grenzen in den Blick zu nehmen.
Plurale Ökonomik macht solche Bezüge zwischen Praxis- und Denkweisen sichtbar. So schafft sie einen reflexiven Rahmen, in dem verschiedene Ansätze nicht gegeneinanderstehen, sondern zusammenarbeiten können. Damit ermöglicht sie ein reflexives Gestalten wirtschaftlicher Normen ebenso wie die Harmonisierung verschiedener Normen nebeneinander. Denn viele gesellschaftliche Fragen lassen sich auf verschiedene Weise angehen oder sogar parallel komplementär verfolgen:
- Beispiel I: Klimaschutz kann als Marktproblem (CO₂-Bepreisung), als gemeinschaftliche Aufgabe (Energiewende von unten) oder als staatliche Infrastrukturpolitik (Netzausbau) behandelt werden.
- Beispiel II: Altersvorsorge kann solidarisch über staatliche Umlagesysteme, individuell über Kapitalmärkte oder durch eine Mischform wie das Drei-Säulen-Modell der OECD geregelt werden.
Statt auf ein gemeinsames Paradigma zu setzen, schafft Plurale Ökonomik Orientierung in der Vielfalt. Sie macht theoretische Voraussetzungen explizit, strukturiert die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Modelle, Konzepte und Werte und fördert so einen reflektierten Umgang mit ökonomischem Wissen.
Drei Erkenntnismodi ökonomischer Forschung
Dabei unterscheidet Plurale Ökonomik drei komplementäre Erkenntnismodi, mit denen ökonomische Wirklichkeit beschrieben, analysiert und gestaltet werden kann. Sie stehen für unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge, die sich nicht ausschließen, sondern ergänzen:
- Empirische/deskriptive Ökonomik – Was ist?
Aufgabe der Deskription ist es zu beschreiben, was der Fall ist. Das bezieht sich auf die Vielfalt der ökonomischen Wirklichkeit, der vielfältigen Möglichkeiten Knappheit zu begegnen und Wohlstand zu schaffen. Dazu gehört die Wirtschaftsgeschichte, die deskriptive Statistik, Wirtschaftsgeographie, Institutionenkunde, qualitative Studien und die Beschreibung der verschiedenen realen Arten und Weisen des Wirtschaftens (konkrete Wirtschaftsstile), sowie der darin enthaltenen Ziellogiken und Konzepte. Ziel ist es, ein differenziertes Orientierungswissen zu schaffen: Karten ökonomischer Realitäten, die Vergleichbarkeit ermöglichen und die Voraussetzungen transparent machen. - Theoretische/hypothetische Ökonomik – Wie wirkt es?
Theorien und Hypothesen entwerfen allgemeine Typen, idealisierte Szenarien oder Kausalzusammenhänge, die nicht eins zu eins die Wirklichkeit beschreiben, sondern mögliche Zusammenhänge und Wirkmechanismen sichtbar machen. Diese Hypothesen werden gespeist sowohl von empirischer Forschung als auch von theoretischer Imagination. Während die deskriptive Ökonomik nah an realen Institutionen und Typen bleibt, finden sich hier eher idealisierte allgemeine Typen oder formalisierte Modelle. Auf jeder Ebene handelt es sich um bestimmte stilistische Denkgebilde, die aus analytischen Konzepten und normativen Zielsetzungen zusammengesetzt sind. Aus der Vielfalt der Ideen und Ideale können auf dieser Ebene neue Modelle entstehen. Der Fokus liegt auf dem Verstehen von Wirkungszusammenhängen und der theoretischen Durchdringung ökonomischer Phänomene. - Gestaltende/angewandte Ökonomik – Was soll wie umgesetzt werden?
Die Gestaltung ist der Bereich, in dem die abstrakten Ideen und Normen in konkrete Handlungsempfehlungen und Institutionen übersetzt werden. Hier wird diskutiert, welche Norm in welcher Situation angemessen ist. Schlussendlich ist das aber immer auch eine politische Frage, die nicht durch die Wissenschaft allein bestimmt werden kann. Gleichwohl entsteht in der Anwendung und Umsetzung selbst praktisches Wissen, das wieder empirisch beschrieben werden kann. Dabei geht es nicht nur um abstrakte Ethik, sondern um die Frage, wie ökonomisches Wissen in gesellschaftliche Aushandlungsprozesse übersetzt werden kann.
Diese drei Erkenntnismodi bilden keinen starren Bauplan, sondern ein dynamisches Feld. Am Anfang steht die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Praxis. Sie wird durch den Reichtum an Ideen und Werten analysiert und erweitert. Daraus werden neue Lösungen und Konzepte auf eine neue Praxis hin entworfen. Was tatsächlich umgesetzt wird und unter welchen Kriterien, ist die Frage der Politik. Der Reichtum der Ideen und Ideale ermöglicht die reflexive Wahl.
Normativität durchzieht alle Ebenen, aber auf unterschiedliche Weise. Damit wird die oft beklagte „Verstrickung" von Fakten und Werten nicht mehr als Problem, sondern als ordnungsfähige Struktur differenziert. Diese drei Erkenntnismodi lassen sich auf drei Ebenen ökonomischer Praxis konkret anwenden:
- Mikroebene: Betrifft das Handeln einzelner im Alltag. (Was kaufen wir? Wofür arbeiten wir? Wie teilen wir auf?)
- Mesoebene: Betrifft die Organisationale Ebene (Wie gestalten wir Unternehmen, Genossenschaften, Verwaltungen, Verbände oder Gewerkschaften?)
- Makroebene: Betrifft die Wirtschaftsordnung und Institutionen einer Gesellschaft (Welche Vielfalt wirtschaftlicher Formen ist rechtlich erlaubt, wie werden sie besteuert? Welche Infrastrukturen werden, geschaffen, welche politischen Rahmenbedingungen? Wie soll Geldpolitik gehandhabt werden?)
Auf jeder dieser Ebenen können Unterschiede empirisch beschrieben (1), theoretisch erklärt oder rekonfiguriert (2) und gestaltet werden (3). Dabei sind die Ebenen sowohl verzahnt als auch komplementär. Wie Menschen lokal wirtschaften, wird durch politische und institutionelle Rahmenbedingungen geprägt, kann diese aber auch selbst verändern. Wenn viele sich genossenschaftlich organisieren oder neue Plattformen nutzen, entstehen neue ökonomische Infrastrukturen. Umgekehrt beeinflusst die Makroebene, welche Formen des Wirtschaftens florieren oder verschwinden. Alle Ebenen stehen in Wechselwirkungen mit der nicht-menschlichen Natur.
Plurale Ökonomik bringt diese Erkenntnismodi und Ebenen systematisch in Verbindung. Sie erlaubt es, zwischen Theorie, Empirie und Norm nicht willkürlich zu springen, sondern bewusst zu wechseln je nach Erkenntnisinteresse, Fragestellung und Kontext. So schafft sie einen disziplinären Möglichkeitsraum für ökonomische Forschung, Lehre und Gestaltung in einer komplexen, pluralen Welt.
Beispiel: Wenn aus einer Strafe eine Dienstleistung wird
Wie wichtig es ist, zwischen deskriptivem, theoretischem und gestaltendem Wissen zu unterscheiden, zeigt ein vielzitiertes ökonomisches Experiment: In mehreren Kindertagesstätten kamen Eltern nach der Arbeit regelmäßig zu spät bei der Abholung ihrer Kinder. Um das Problem zu lösen, führten manche Einrichtungen eine Geldstrafe für Verspätungen ein als Anreiz zur Pünktlichkeit. Das Ergebnis war überraschend: Statt weniger kamen nun noch mehr Eltern zu spät. Wie konnte das passieren?
Aus traditioneller ökonomischer Sicht wurde ein Anreiz gesetzt. Doch auf der Alltagsebene veränderte der Anreiz die Interpretation der Situation: Die Verspätung galt nicht mehr als unhöflich oder problematisch und führte zu einem schlechten Gewissen, sondern wurde als legitime Dienstleistung verstanden, die man Kaufen kann.
Die soziale Norm wurde durch eine Marktlogik ersetzt. Als die Strafe später wieder abgeschafft wurde, blieb das Verhalten bestehen; die alte Norm war nicht mehr ohne Weiteres wiederherstellbar (Gneezy et al., 2013). Dieses Beispiel zeigt:
- Standardmodelle können dazu führen, dass wirtschaftliche Situationen auf eine bestimmte Weise interpretiert werden, die zu unintendierten Konsequenzen führt.
- Moderne ökonomische Forschung nimmt heute auch nicht monetäre Anreize zur Kenntnis.
- Empirisch mag ein „Anreiz“ funktionieren, aber auf welche Art und Weise etwas «funktionieren» soll ist auch eine normative Frage.
Plurale Ökonomik ermöglicht hier systematisch nicht nur zu fragen, ob eine Geldstrafe wirksam ist, sondern in welchem Kontext, mit welchem normativen Verständnis von Elternschaft, welcher Vorstellung von Verantwortung und ob andere Optionen, etwa Gesprächsangebote oder Kooperationsvereinbarungen, angemessener wären.
Historische Entwicklung und Begriffsklärung
Der Begriff der Pluralen Ökonomik wurde im Laufe der Zeit unterschiedlich verwendet. Alle Bedeutungen lassen sich nur vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Vorherrschaft eines methodologischen Grundtyps innerhalb der Wirtschaftswissenschaften verstehen.
Economics – Disziplinäre Einheit qua Methode
Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte sich ein formal eleganter, axiomatisch fundierter Theorieansatz. Lehrbücher wie jenes von Samuelson und nach ihm Mankiw und andere Autoren prägten weltweit ein einheitliches Bild davon, wie «ein Ökonom zu denken» habe (Colander, 2011; Skousen, 1997). Damit löste die «Economics» als an der Physik orientierter disziplinärer Deutungsrahmen den eher praktisch orientierten Deutungsrahmen der «Politischen Ökonomie» ab (Ötsch and Graupe, 2020). Eigenständige empirische Forschung trat dadurch zunächst in den Hintergrund (Backhouse and Cherrier, 2017). Dieses Paradigma basierte auf einem Menschenbild des rational entscheidenden Individuums und betrachtete wirtschaftliche Prozesse primär als Gleichgewichtsdynamik. Die Arbeitsteilung war klar. Theoretiker entwickelten Modelle, empirische Ökonomen wendeten sie auf die Empirie an, normative Empfehlungen basierten auf formalen Kriterien aufbauend auf ökonomischer Theorie. Der Erfolg dieses Kanons lässt sich auch aus dem politischen Kontext verstehen (Colander, 2011). Im Kalten Krieg wuchs das Bedürfnis nach vermeintlich neutralen Steuerungsinstrumenten. Zugleich dominierte eine positivistische Wissenschaftsauffassung, die Wirtschaft als wertfreie Analyse effizienter Allokationen verstand (Davis, 2017; Mirowski, 1991).
Plurale Ökonomik als forschungspolitischer Kampfbegriff
Unterschiedliche Bewegungen, die sich zu unterschiedlichen Zeiten gegen die orthodoxen Lehrbuchwahrheiten gerichtet haben, haben den Begriff der Pluralität bereits für sich beansprucht. Schon 1992 warnten namhafte Ökonom:innen, darunter Paul Samuelson, in der American Economic Review vor einem «intellektuellen Monopol» in Bezug auf Theorien und Methoden der Disziplin (Hodgson et al., 1992). Sie forderten eine «plurale und zugleich rigorose Ökonomik». Ein Aufruf, der als Wendepunkt gelesen werden kann. In der Tat ist seit den 1980er Jahren eine Diversifizierung ökonomischer Forschung zu beobachten: Verhaltensökonomie, neue institutionenökonomische Ansätze, «Mechanism Design», experimentelle Methoden und neue empirische Zugänge gewinnen an Bedeutung. Namen wie Kahneman, Card, Shiller, Duflo, Chetty, Piketty oder Rodrik stehen für diese Öffnung. Immer mehr Kolleg:innen sprechen von dem Verlust einer gemeinsamen Sprache im aktuellen Forschungsgeschehen, einem Sinnverlust oder einer neuen offenen intellektuellen Kultur (Banerjee et al., 2017; Becker et al., 2017; Beise et al., 2016; Falk et al., 2021; Tirole, 2017, Weimann 2019; Bachmann 2019).
Wie tiefgreifend dieser Wandel ist, bleibt umstritten. Manche sprechen von dem «Tod der Neoklassik» oder einem neuen «Mainstream-Pluralismus» (Colander, 2000; Davis, 2006) bzw. einer zunehmenden Fragmentierung (Cedrini and Fontana, 2018; Roncaglia, 2019). Andere zeigen eine anhaltende thematische Konzentration etwa bei Publikationen, Zeitschriften, Berufungspraktiken oder Förderlogiken auf (Aigner et al., 2025; Aistleitner et al., 2019; Fontana et al., 2019; Fontana et al., 2023; Glötzl and Aigner, 2019).
Gegenstimmen stammen vor allem von heterodoxen Ökonomen, die sich schon seit langem gegen die orthodoxen Lehrbuchwahrheiten richten. «Dissenter» in der Tradition Sraffas, marxistische, postkeynesianische, ökologische, oder feministische Ökonomen, die sich seit Jahrzehnten gegen die Orthodoxie des Fachs richten, bezeichnen sich selbst in der Summe heute oft als Plurale Ökonomik. Von dieser Seite wird kritisiert, dass heterodoxe Ansätze weiterhin ausgeschlossen bleiben (Heise et al., 2016; Heise et al., 2016; Reinke 2024) und qualitative Forschungsmethoden nach wie vor eine untergeordnete Rolle spielen (Lenger 2019, Porak et al. 2024). Hier wird im Folgenden von Heterodoxer Pluralität gesprochen.
In diesem Diskursfeld wird Pluralität mal für die eine Seite und mal für die andere Seite in Anspruch genommen. Es fehlt ein klareres methodologisches Verständnis des Begriffs, um Plurale Ökonomik nicht in Beliebigkeit («Anything Goes») oder Lagerdenken aufzulösen (Gräbner und Strunk, 2020).
Plurale Ökonomik als bildungspolitische Forderung
Ungeachtet der Debatte um eine zunehmende Fragmentierung ökonomischer Forschung vermittelt ökonomische Bildung weiterhin ein uniformes, scheinbar gesichertes Denkgebäude. Der Kanon hat sich seit den 1980er Jahren nicht substanziell verändert (Allgood et al., 2015; Rommel et al., 2022) und ist nahezu weltweit verbreitet (de Muijnck, 2025; Decker et al., 2018; Proctor, 2019).
Initiativen wie Rethinking Economics oder das Netzwerk Plurale Ökonomik fordern daher eine stärkere Öffnung der Lehre: mehr Methodenvielfalt, mehr Theorien, mehr gesellschaftliche Relevanz. In diesem Kontext wird Plurale Ökonomik mit einer bildungspolitischen Forderung verbunden und auch als soziale Bewegung begriffen (NWPÖ 2012, ISIPE, 2014, Euler et al. 2013).
Die Kritik an der Lehre wurde inzwischen vielfach empirisch erhärtet durch Studien zu Verzerrungen in Lehrbüchern, dem Lehrbuchmarkt und gegenwärtiger Didaktik (Bäuerle, 2022; Graupe, 2017; Green, 2012; Peukert, 2018; Pühringer and Bäuerle, 2018; van Treeck et al., 2017). Sie hat zudem erste Wirkungen gezeigt: So hat etwa Gregory Mankiw in der neuesten Auflage seines Lehrbuchs ein Kapitel zu heterodoxen Ansätzen ergänzt und den Geltungsanspruch des eigenen Ansatzes spürbar relativiert (Mankiw, 2024, 52). Zudem gibt es immer mehr plural orientierte Einführungswerke (Gibson-Graham, 2008; Staveren, 2014; Reardon et al., 2017; Schneider, 2025). Auch Umfragen zeigen: Immer mehr Ökonom:innen verstehen sich selbst als plural orientiert (Falk et al., 2021; Fricke, 2018).
Aufbruch: Fragmentierung der Disziplin auf methodologischer Ebene
Die Erkundung Pluraler Ökonomik als eigenständigen Disziplinbegriff in diesem Artikel geht aus von der Diagnose einer Fragmentierung ökonomischer Forschung auf methodologischer Ebene (Rommel 2025). Sie basiert auf der Beobachtung, dass der traditionelle methodologische Grundtyp, auf dem sich die Einheitlichkeit der Disziplin bis Mitte des 20. Jahrhunderts etabliert hat, brüchig geworden ist. Innerhalb der ökonomischen Theorie selbst wurden Grenzen sichtbar, etwa durch das Sonnenschein-Mantel-Debreu-Theorem, welches zentrale Resultate in Frage stellte (Sent, 2006). In der Folge kam es seit den 1980er Jahren zu mindestens drei unterschiedlichen methodologischen Trends, die den traditionellen methodologischen Grundtyp überschreiten und sich von der Allgemeingültigkeit einer Theorie distanziert haben.
- Theoretische Öffnung: Anstelle der Suche nach der richtigen Theorie und einer konsistent auf sie aufbauenden Modellwelt tritt die Verwendung eines breiten Modellportfolios basierend auf einander widersprechenden Annahmen (Rodrik 2015, Grüne-Yanhoff 2018).
- Empirische Ausweitung: Empirische Forschung orientiert sich heute verstärkt unabhängig von theoretischen Modellen entlang eigener methodischer Standards, wie kontrollierten Feldexperimenten oder Big-Data-Analysen, und zielt auf die Identifikation lokaler Kausalitäten.
- Normative Designwende: Zugleich wird die klassische Theorie normativ gewendet und als Ideal für die Gestaltung realer wirtschaftlicher Prozesse und Funktionen genutzt.
Entlang dieser drei Entwicklungen, denen sich jeweils grosse Teile gegenwärtiger Publikationen zurechnen lassen, lässt sich die Forschungslandschaft als methodologisch fragmentiert beschreiben. Verschiedene Subdisziplinen arbeiten mit unterschiedlichen Begriffen, Methoden und Zielen oft ohne gemeinsamen Referenzrahmen. In der Folge kommt es zu unreflektierter Normativität (Davis 2017) und Verzerrungen infolge lokaler methodischer Standards (Akerlof 2020) und disziplinärer Dynamiken und Bewertungslogiken (Heckmann 2020). Die disziplinäre Einheit des alten methodologischen Grundtyps definiert nicht länger den Rahmen der Disziplin und der Begriff «Ökonomik» scheint mehrdeutig geworden zu sein.
Genau an diesem Punkt setzt das hier vertretene Verständnis von Pluraler Ökonomik an. Es begreift die gegenwärtige Situation nicht einfach als Beliebigkeit oder Methodenstreit, sondern als Folge eines methodologischen Wandels. Dieser macht einen neuen methodologischen Grundtyp als reflexiver disziplinärer Rahmen nötig.
Wissenschaftsphilosophie der Pluralen Ökonomik
Für den disziplinären Wandel der Wirtschaftswissenschaften zu einer Pluralen Wissenschaft spricht auch die Kehrtwende der Wissenschaftsphilosophie im 20. Jahrhundert.
Vom Ideal der Einheit zur Vielfalt der Methoden
Lange Zeit galt die Vorstellung, Wissenschaft müsse nach einer einheitlichen Methode logisch, neutral und mathematisch vorgehen. Diese Idee wurde besonders durch den Wiener Kreis in den 1920er und 1930er Jahren geprägt. Ziel war es, durch logische Klarheit und empirische Nachprüfbarkeit ein allgemeines Kriterium für Wissenschaftlichkeit zu etablieren. Auch die Wirtschaftswissenschaft orientierte sich stark an diesem Ideal, indem sie formale Modelle, Mathematisierung und die Idee der «Wertfreiheit» setzte. Die Physik diente vielen als Vorbild.
Doch diese Vorstellung erwies sich als nicht haltbar. In der Praxis folgten Wissenschaftler:innen sehr unterschiedlichen Wegen, und philosophisch ließ sich kein allgemeingültiges Kriterium für Wissenschaftlichkeit finden, auch nicht in der Physik. Spätestens mit den Arbeiten von Karl Popper, Thomas Kuhn und Paul Feyerabend wurde klar: Wissenschaftlicher Fortschritt entsteht nicht durch einen festen Pfad, sondern durch Vielfalt, Streit und Perspektivwechsel (Feyerabend 1978; Kuhn 1962; Caldwell 2015).
Methodologischer Pluralismus: Vielfalt mit Struktur
Heute ist in der Wissenschaftsphilosophie weitgehend anerkannt: Es gibt nicht die eine wissenschaftliche Methode. Stattdessen wird ein methodologischer Pluralismus vertreten, also die Einsicht, dass unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze sinnvoll und notwendig sind.
Philosoph:innen wie Nancy Cartwright und Paul Hoyningen-Huene betonen, dass Wissenschaft nicht linear ist, sondern kontextbezogen, lokal, modellbasiert. Sie funktioniert eher wie ein Werkzeugkasten als wie ein geschlossenes System (Cartwright 1999; Hoyningen-Huene 2020). Unterschiedliche Probleme brauchen unterschiedliche Methoden. Das bedeutet nicht Beliebigkeit, sondern einen gut begründeten, vergleichbaren und strukturierten Umgang mit Vielfalt. Michela Massimi (2022) unterstreicht diese Perspektive, indem sie argumentiert, dass wissenschaftliche Objektivität nicht durch methodische Einheitlichkeit, sondern durch die Integration verschiedener epistemischer Standpunkte und kultureller Kontexte erreicht wird. Der Physikhistoriker Peter Galison spricht in diesem Zusammenhang von «Trading Zones», Schnittstellen zwischen verschiedenen Forschungsstilen. Hier entstehen neue Erkenntnisse gerade durch den Austausch zwischen unterschiedlichen Herangehensweisen (Galison et al. 1996).
Reflexiver Pluralismus in der Ökonomik
Entsprechend gibt es auch in den Wirtschaftswissenschaften nur noch wenige, die ein einheitliches Paradigma vertreten (Lazear 2015). Stattdessen wird Vielfalt als Stärke gesehen, die aber durchaus mit Kosten einhergeht und einer Struktur bedarf, um nicht in eine Beliebigkeit abzudriften (Becker et al. 2017; Garnett 2011; Gräbner und Strunk 2020, Lari et al. 2024).
Die Ökonomin Sheila Dow hat dafür den Begriff des strukturierten Pluralismus geprägt (Dow 2004). Das erfordert auch, über die Grundannahmen der verschiedenen Theorien nachzudenken. Diese unterscheiden sich zwischen den Theorien zum Teil erheblich, was oft als Problem der Inkommensurabilität des Pluralismus bezeichnet wird (Bigo et al. 2008; Lawson 2015; Mäki 1997). Aufschlussreiche Übersichtskarten insbesondere mit Blick auf Heterodoxe Pluralität finden sich im Bereich Orientieren auf dieser Homepage. In seinem Spätwerk betonte auch Karl Popper, dass sich in den Sozialwissenschaften keine allgemeingültigen Gesetze formulieren lassen. Wirtschaftstheorie kann aber sehr wohl beschreiben, wie sich Institutionen und wirtschaftliche Praktiken stabilisieren und verändern (Badiei 2024).
Daran anknüpfend schlagen Rommel und Kasperan (2022) vor, die Vielfalt ökonomischer Theorien direkt auf die Vielfalt realer Wirtschaftsformen zu beziehen. Wenn Wirtschaft in der Praxis plural ist, warum sollte das wissenschaftliche Denken darüber nicht ebenso vielfältig sein? Theorien lassen sich so als unterschiedliche Zugänge zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Wirklichkeiten verstehen. Und wo sich diese Lebensformen und Wirtschaftsweisen grundlegend unterscheiden, müssen und dürfen auch Theorien unterschiedlich und damit inkommensurabel bleiben.
Plurale Ökonomik als disziplinärer Möglichkeitsraum
Plurale Ökonomik versteht sich nicht als neue Schule, sondern als methodologischer Rahmen für die Wirtschaftswissenschaften. Sie bringt die Vielfalt realer Wirtschaftsformen mit der Vielfalt wirtschaftswissenschaftlicher Denkweisen in ein systematisches Verhältnis und eröffnet so einen Möglichkeitsraum für Forschung, Lehre und gesellschaftliche Gestaltung.
In einer Zeit multipler Krisen, ökologisch, sozial, geopolitisch, und gesellschaftlicher Polarisierung genügt es nicht, auf ein einziges Modell oder Paradigma zu setzen. Gefragt ist die Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln, Alternativen zu denken und Erkenntnisse interdisziplinär und kontextsensitiv zu entwickeln.
Plurale Ökonomik schafft einen Raum, in dem die vielfältigen Forschungsströmungen der letzten Jahrzehnte aufeinander bezogen werden können. Sie schafft eine Sprache für das bereits Gewordene und eine Orientierung für das, was möglich ist. So ermöglicht sie auch für die ökonomische Bildung einen zeitgemäßen Einstieg. Wer Wirtschaft verstehen will, muss lernen, zwischen Perspektiven zu wechseln, nicht nur theoretisch, sondern auch institutionell und praktisch. Plurale Ökonomik setzt deshalb auf ein erweitertes Curriculum, das neben Konzepten und Modellen auch ökonomische Praktiken, historische Kontexte und gesellschaftliche Werte vermittelt.
Denn wie Menschen wirtschaften, ist immer auch Ausdruck dessen, wie sie leben wollen und wer darüber mitbestimmen darf. Eine reflexiv strukturierte plurale Wirtschaftswissenschaft ist damit nicht nur wissenschaftlich angemessen, sondern auch förderlich für eine offene und harmonische Gesellschaft.
Literatur
Aigner, E., Greenspon, J., Rodrik, D., 2025. The global distribution of authorship in economics journals. World Dev. 189, 106926.
Aistleitner, M., Kapeller, J., Steinerberger, S., 2019. Citation patterns in economics and beyond. Sci. Context 32, 361–380. https://doi.org/10.1017/S0269889720000022
Akerlof, G. A. (2020). Sins of Omission and the Practice of Economics. Journal of economic Literature, 58(2), 405-418.
Allgood, S., Walstad, W.B., Siegfried, J.J., 2015. Research on teaching economics to undergraduates. J. Econ. Lit. 53, 285–325.
Bachmann, R., 2019. Erfolge und Probleme der modernen (Mainstream-) Makroökonomik, in: List Forum Für Wirtschafts-Und Finanzpolitik. Springer, pp. 451–493.
Backhouse, R.E., Cherrier, B., 2017. The age of the applied economist: the transformation of economics since the 1970s. Hist. Polit. Econ. 49, 1–33.
Badiei, S., 2024. Normative Economics in the History of Economic Thought: Marx, Mises, Friedman and Popper. Routledge.
Banerjee, A., Banerji, R., Berry, J., Duflo, E., Kannan, H., Mukerji, S., Shotland, M., Walton, M., 2017. From Proof of Concept to Scalable Policies: Challenges and Solutions, with an Application. J. Econ. Perspect. 31, 73–102. https://doi.org/10.1257/jep.31.4.73
Bäuerle, L., 2022. Ökonomie-Praxis-Subjektivierung: Eine praxeologische Institutionenforschung am Beispiel ökonomischer Hochschulbildung. transcript Verlag.
Becker, J., Dullien, S., Bachmann, R., Graupe, S., Heise, A., 2017. Wirtschaftswissenschaften: zu wenig Pluralität der Methoden und Forschungsrichtungen? Wirtschaftsdienst 97, 835–853.
Beise, M., Schäfer, U., Hoffmann, C., 2016. Denk doch, wie du willst: Überraschende Einblicke von Deutschlands wichtigsten Ökonomen. Süddeutsche Zeitung, München.
Bigo, V., Negru, I., others, 2008. From fragmentation to ontologically reflexive pluralism. J. Philos. Econ. 1, 127–150.
Boldyrev, I., Svetlova, E., 2016. Enacting Dismal Science: New Perspectives on the Performativity of Economics. Palgrave Macmillan, New York, NY, USA.
Caldwell, B., 2015. Beyond Positivism. Routledge.
Cartwright, N., 1999. The dappled world: A study of the boundaries of science. Cambridge University Press.
Cedrini, M., Fontana, M., 2018. Just another niche in the wall? How specialization is changing the face of mainstream economics. Camb. J. Econ. 42, 427–451.
Colander, D., 2000. The death of neoclassical economics. J. Hist. Econ. Thought 22, 127–143. https://doi.org/10.1080/10427710050025330
Colander, D.C., 2011. 12 The evolution of US economics textbooks1. Econ. Read. Textb. Man. Dissem. Econ. Sci. Ninet. Early Twent. Centuries 136, 324.
Davis, J., 2017. Is Mainstream Economics a Science Bubble? Rev. Polit. Econ. 29, 523–538. https://doi.org/10.1080/09538259.2017.1388983
Davis, J.B., 2006. The turn in economics: neoclassical dominance to mainstream pluralism? J. Institutional Econ. 2, 1–20.
de Muijnck, S., 2025. EconEdu.org [WWW Document]. Econ. Educ. URL https://www.economicseducation.org/current-curriculum (accessed 7.21.25).
Decker, S., Elsner, W., Flechtner, S., 2018. Advancing Pluralism in Teaching Economics: International Perspectives on a Textbook Science. Routledge.
Dow, S.C., 2004. Structured pluralism. J. Econ. Methodol. 11, 275–290.
Düppe, T., 2015. Border cases between autonomy and relevance: Economic sciences in Berlin—A natural experiment. Stud. Hist. Philos. Sci. Part A 51, 22–32. https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2015.01.004
Dürmeier, T., Euler, J., 2013. Warum in der Wirtschaftswissenschaft keine Pluralität entsteht. Kurswechsel 1/2013, 24–40.
Falk, A., Andre, P., 2021. What’s Worth Knowing? Economists’ Opinions About Economics. SSRN Electron. J. https://doi.org/10.2139/ssrn.3885426
Feyerabend, P.K., 1978. Von der beschränkten Gültigkeit methodologischer Regeln, in: Der Wissenschaftstheoretische Realismus Und Die Autorität Der Wissenschaften. Springer, pp. 205–248.
Fleck, L., 1935. Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache: Einführung in die Lehre von Denkstil und Denkkollektiv. Suhrkamp. Frankfurt am Main.
Fontana, M., Iori, M., 2023. The Fragmentation of the Mainstream and Communication in Economics: A View from the Top. ØEconomia Hist. Methodol. Philos. 323–355.
Fontana, M., Montobbio, F., Racca, P., 2019. Topics and Geographical Diffusion of Knowledge in Top Economic Journals. Econ. Inq. 57, 1771–1797. https://doi.org/10.1111/ecin.12815
Fricke, T., 2018. Altes Einheitsdenken oder neue Vielfalt? Eine systematische Auswertung der gro\s sen Umfragen unter Deutschlands Wirtschaftswissenschaftler_innen. FGW-Publ. Neues Ökon. Denk. 3.
Galison, P.L., Stump, D.J., 1996. The disunity of science: Boundaries, contexts, and power. Stanford University Press.
Garnett Jr, R.F., 2011. Pluralism, academic freedom, and heterodox economics. Rev. Radic. Polit. Econ. 43, 562–572.
Gibson-Graham, J.K., 2008. Diverse economies: performative practices forother worlds’. Prog. Hum. Geogr. 32, 613–632.
Glötzl, F., Aigner, E., 2019. Six Dimensions of Concentration in Economics: Evidence from a Large-Scale Data Set. Sci. Context 32, 381–410. https://doi.org/10.1017/S0269889720000034
Gneezy, U., List, J.A., 2013. The Why Axis: Hidden Motives and the Undiscovered Economics of Everyday Life. Public Affairs, New York [NY].
Gräbner, C., Strunk, B., 2020. Pluralism in economics: its critiques and their lessons. J. Econ. Methodol. 27, 311–329.
Graupe, S., 2017. Beeinflussung und Manipulation in der ökonomischen Bildung: Hintergründe und Beispiele, FGW- Impuls Neues ökonomisches Denken. Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung e.V. (FGW), Düsseldorf.
Green, T.L., 2012. Introductory economics textbooks: what do they teach about sustainability? Int. J. Plur. Econ. Educ. 3, 189–223.
Grüne-Yanoff, T., & Marchionni, C. (2018). Modeling model selection in model pluralism. Journal of Economic Methodology, 25(3), 265-275.
Hacking, I., 1992. ‘Style’for historians and philosophers. Studies in History and Philosophy of Science Part A 23, 1–20.
Heckman, J.J., Moktan, S., 2020. Publishing and Promotion in Economics: The Tyranny of the Top Five. Journal of Economic Literature 58, 419–470.
Heise, A., Sander, H., Thieme, S., 2016. Das Ende der Heterodoxie?: Die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften in Deutschland. Springer-Verlag.
Heise, A., Thieme, S., 2016. The Short Rise and Long Fall of Heterodox Economics in Germany After the 1970s: Explorations in a Scientific Field of Power and Struggle. J. Econ. Issues 50, 1105–1130. https://doi.org/10.1080/00213624.2016.1249752
Hodgson, G.M., Mäki, U., McCloskey, D.N., others, 1992. Plea for a pluralistic and rigorous economics. Am. Econ. Rev. 82, 25.
Hoyningen-Huene, P., 2011. Irrationalität in der Wissenschaftsentwicklung? Ration. Irrationalität Den Wiss. 38–53.
Hoyningen-Huene, P., 2020. The heart of science: Systematicity. Compet. Knowledges–wissen Im Widerstreit 9, 85.
ISIPE, 2014. ent Initiative for PLuralimsin Economics [WWW Document]. Int. Stud. Initiat. Plur. Econ. URL http://www.isipe.net/ (accessed 3.26.18).
King, J.E., 2002. Three arguments for pluralism in economics. J. Aust. Polit. Econ. 82.
Kuhn, T., 1962. The structure of scientific revolutions.
Lari, T., & Mäki, U. (2024). Costs and benefits of diverse plurality in economics. Philosophy of the Social Sciences, 54(5), 412-441.
Lawson, T., 2015. Essays on: The nature and state of modern economics. Routledge.
Lazear, E.P., 2015. Gary Becker’s Impact on Economics and Policy. Am. Econ. Rev. 105, 80–84.
Lenger, A. (2019): The rejection of qualitative research methods in economics. Journal of Economic Issues, 53 (4), 946-965.
Maeße, J., Pahl, H., Sparsam, J., 2016. Die Innenwelt der Ökonomie: Wissen, Macht und Performativität in der Wirtschaftswissenschaft. Springer-Verlag.
Mäki, U., 1997. The one world and the many theories. Plur. Econ. Eds Salanti E Screpanti Edw. Elgar Chelten. Glos Pp 37–47.
Mankiw, N.G., 2024. Makroökonomik, 8th ed. Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
Massimi, M. (2022). Perspectival Realism. Oxford University Press.
Mirowski, P., 1991. More Heat Than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature’s Economics. Cambridge University Press.
NWPÖ, N.P.Ö., 2012. Offener Brief [WWW Document]. Accessed April. URL https://www.plurale-oekonomik.de/projekte/offener-brief/
Ötsch, W.O., Graupe, S., 2020. Imagination und Bildlichkeit der Wirtschaft: Zur Geschichte und Aktualität imaginativer Fähigkeiten in der Ökonomie. Springer-Verlag.
Pahl, H., 2013. Zur performativen Dimension konstitutiver Metaphern in der ökonomischen Theoriebildung: Zwischen Disziplinarität und Gesellschaft, in: Ökonomie, Diskurs, Regierung. Springer, pp. 277–298.
Perry, J., Nölke, A., 2006. The political economy of International Accounting Standards. Rev. Int. Polit. Econ. 13, 559–586. https://doi.org/10.1080/09692290600839790
Peukert, H., 2018. Makroökonomische Lehrbücher: Wissenschaft oder Ideologie? Metrolopolis-Verlag.
Porak, L. und Reinke, R. (2024): The contribution of qualitative methods to economic research in an era of polycrisis. Review of Evolutionary Political Economy, 5 (1), 31-49.
Proctor, J.C., 2019. Mapping Pluralist Research.
Pühringer, S., Bäuerle, L., 2018. What economics education is missing: the real world. Int. J. Soc. Econ.
Reardon, J., Madi, M.A.C., Cato, M.S., 2017. Introducing a new economics: pluralist, sustainable and progressive. Pluto Books.
Reinke, R. (2024): Economics in Germany: About the unequal distribution of power. Journal of Economic Issues, 58 (1), 302-326.[FR4]
Rommel, F., Kasperan, R.L., 2022. Pluralism is not “anything goes” - grounding pluralism in economics in diverse economies by rehabilitating Paul Feyerabend. Int. J. Plur. Econ. Educ. 13, 43–71. https://doi.org/10.1504/IJPEE.2022.124575
Rommel, F., Urban, J., 2022. A Survey of German Economics. Conference Paper VFS- Jahrestagung Basel 2022 30.
Rommel, F.; 2025. From Fragmentation to Pluralism. It's the dawn of economics (as we want it). Conference Paper ESHET Conference Turin. https://www.eshet-conference.net/torino/ed2025/papers/516/
Roncaglia, A., 2019. The Age of Fragmentation: A History of Contemporary Economic Thought. Cambridge University Press.
Salanti, A., Screpanti, E., 1997. Pluralism in economics: new perspectives in history and methodology. Edward Elgar Publishing.
Schefold, B., 1994. Wirtschaftsstile. 1. Studien zum Verhältnis von Ökonomie und Kultur. Fischer-Taschenbuch-Verlag.
Schefold, B., 2014. Geld, Wirtschaftsstile und der Euro. Geldkulturen 133–155. https://doi.org/10.30965/9783846754610_013
Schefold, B., 2015. Wirtschaftsstile: Teil 2: Studien zur ökonomischen Theorie und zur Zukunft der Technik. S. Fischer Verlag.
Schneider, G., 2025. Economic Principles and Problems: A Pluralist Introduction, 2nd ed. Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9781032619774
Sent, E.-M., 2006. Pluralism in Economics, in: Kellert, S.H., Longino, H.E. (Eds.), Scientific Pluralism. U of Minnesota Press, pp. 80–102.
Skousen, M., 1997. The perseverance of Paul Samuelson’s economics. J. Econ. Perspect. 11, 137–152.
Spiethoff, A., 1952. The “historical” character of economic theories. The Journal of Economic History 12, 131–139.
Staveren, I. van, 2014. Economics After the Crisis: An Introduction to Economics from a Pluralist and Global Perspective. Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9781315793962
Thieme, S., 2015. Spiethoff’s economic styles approach: An orientation for pluralistic economists? Economic Thought 10, 12.
Tirole, J., 2017. Economics for the Common Good. Princeton University Press.
van Treeck, T., Urban, J., van Treeck, T., 2017. Wirtschaft neu denken: Blinde Flecken in der Lehrbuchökonomie. iRights Media.
Weimann, J., 2019. Mikroökonomie heute: ihre Bedeutung im Konzert der Methoden, in: List Forum Für Wirtschafts-Und Finanzpolitik. Springer, pp. 407–432.
Kommentar von unseren Editor*innen:
Dieser Text darf als vorläufiges Resultat einer disziplinären Selbstvergewisserung in einer Zeit raschen Wandels in den Wirtschaftswissenschaften gesehen werden. Er ist in engem Austausch mit zentralen Befürwortern ebenso wie Kritikern einer Pluralen Ökonomik entstanden und dadurch vielen Kolleg:innen zum Dank verpflichtet. Die nächste Überarbeitung findet im Herbst 2026 statt. Anregungen dafür sind herzlich willkommen an: florian.rommel@hfgg.de
Licensed under EE Originals