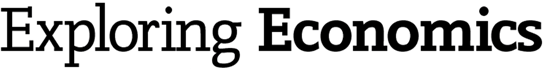Vom Staat ins Portemonnaie – die Reihenfolge der Staatsfinanzen
Exploring Economics, 2025
In öffentlichen Debatten über Staatsschulden, Haushaltsdefizite und Steuern herrscht oft die Vorstellung, der Staat müsse sich Geld „beschaffen“, bevor er ausgeben könne – entweder über Steuern oder Schuldenaufnahme. Diese Vorstellung überträgt die Logik privater Haushalte auf staatliches Handeln und verkennt die Struktur moderner Geldsysteme.
Moderne Geldsysteme funktionieren zweistufig: Auf der ersten Ebene schaffen der Staat und die Zentralbank das sogenannte Basisgeld – Zentralbankreserven und Bargeld. Auf der zweiten Ebene führen die Geschäftsbanken den Zahlungsverkehr der privaten Wirtschaft in Form von Bankeinlagen. Die Abwicklung der Überschüsse und Defizite, die dabei zwischen den Geschäftsbanken entstehen, erfolgt ebenfalls in Zentralbankgeld (Basisgeld).
Nur Basisgeld kann letztlich für Steuerzahlungen verwendet werden. Wer Steuern zahlt, bewirkt damit im Hintergrund eine Überweisung von Basisgeld von seiner Bank an den Staat. Das bleibt Privatpersonen meist verborgen, da sie im Alltag nur ihre Kontenbewegungen in Buchgeld sehen. Sie zahlen scheinbar mit Giralgeld – in Wirklichkeit sorgt ihre Bank im Hintergrund dafür, dass die Steuerzahlung in Basisgeld beglichen wird.
Der Staat ist also nicht Nutzer eines Geldes, das „woanders“ herkommt, sondern er kreiert es selbst – auf der ersten Stufe des Geldsystems. Staatliche Ausgaben stehen am Anfang des Geldkreislaufs. Der Staat gibt Basisgeld aus, bevor irgendjemand es besitzen, verwenden oder in Form von Steuern abführen kann. Die Kreierung dieses Basisgeld führt zur Schaffung neuer Bankeinlagen auf der zweiten Stufe, die wir im Alltag nutzen.
Geld als rechtliche Institution
Der deutsche Ökonom Georg Friedrich Knapp prägte bereits Anfang des 20. Jahrhunderts den Satz: Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Damit brachte er eine bis heute zentrale Einsicht auf den Punkt: Geld entsteht nicht durch Tausch, Vertrauen oder natürliche Knappheit, sondern durch gesetzliche Festlegung. Der Staat bestimmt, was als gesetzliches Zahlungsmittel gilt – etwa der Euro – und verlangt die Erfüllung steuerlicher Pflichten ausschließlich in dieser Währung.
Konkret heißt das: Steuern müssen in Basisgeld entrichtet werden. Das bedeutet nicht, dass der Steuerzahler selbst physisch mit Bargeld oder Zentralbankreserven zahlt. Vielmehr sorgt seine Bank dafür, dass im Zuge der Steuerzahlung das erforderliche Basisgeld an den Staat überwiesen wird – aus den Zentralbankreserven der Bank. Der Steuerzahler sieht davon nur, dass sein Bankguthaben reduziert wird. Im Hintergrund wird die Steuerzahlung jedoch in Basisgeld abgewickelt.
Diese Ordnung erzeugt eine strukturelle Nachfrage nach staatlichem Geld: Steuerpflichtige Haushalte und Unternehmen benötigen Basisgeld (indirekt über ihre Bank), um ihren Steuerpflichten nachzukommen.
Staatliches Basisgeld gelangt durch öffentliche Ausgaben in Umlauf: Gehälter für Staatsbedienstete, Rentenzahlungen, Sozialtransfers oder Investitionen. Auf der ersten Stufe führt der Staat diese Ausgaben aus, indem er Zentralbankgeld in das Bankensystem bringt. Dadurch entstehen auf der zweiten Stufe neue Bankeinlagen im Privatsektor. Wenn später Steuern gezahlt werden, verringern sich beide Aggregate wieder, weil die privaten Konten reduziert werden und im Hintergrund Basisgeld von den Banken an das staatliche Konto überwiesen wird. Ohne vorherige staatliche Ausgaben gäbe es jedoch weder ausreichende Bankeinlagen noch das dafür nötige Basisgeld – niemand im Privatsektor könnte seine Steuern zahlen.
Das zweistufige Geldsystem
Wie bereits beschrieben, entsteht auf der ersten Stufe durch staatliche Ausgaben und Zentralbankoperationen Basisgeld – Zentralbankreserven und Bargeld. Dieses Basisgeld gelangt über die Geschäftsbanken in den Wirtschaftskreislauf und bildet die Grundlage für das gesamte Zahlungssystem.
Im Folgenden betrachten wir die zweite Stufe: den Zahlungsverkehr und die Geldschöpfung innerhalb der privaten Wirtschaft. Hier entstehen und zirkulieren Bankeinlagen – also die Guthaben, die Haushalte und Unternehmen auf ihren Konten bei Geschäftsbanken halten. Diese Einlagen entstehen nicht nur durch staatliche Ausgaben, sondern auch durch private Kreditvergabe: Wenn eine Geschäftsbank einen Kredit vergibt, schafft sie gleichzeitig neues Giralgeld (Bankgeld) in Form von Einlagen und verbucht eine entsprechende Forderung gegenüber dem Kreditnehmer. Auf diese Weise wird auf der zweiten Stufe zusätzliches Geld geschaffen, das für alltägliche wirtschaftliche Transaktionen verwendet wird.
Geld kann also auf zwei Wegen entstehen: durch das staatliche System, wenn der Staat Ausgaben tätigt und Basisgeld in Umlauf bringt – und innerhalb der privaten Wirtschaft, wenn Geschäftsbanken durch Kreditvergabe neues Giralgeld schaffen.
Staatsanleihen: Geldschöpfung rückwärts erklärt
Oft heißt es, der Staat müsse sich Geld „leihen“, um seine Ausgaben zu finanzieren. Tatsächlich ist der Ablauf genau umgekehrt: Der Staat gibt Basisgeld aus – auf der ersten Stufe – und schafft dadurch direkt neues staatliches Geld im Umlauf sowie höhere Bankeinlagen der Empfänger auf der zweiten Stufe.
Erst nach diesen Ausgaben gibt der Staat Staatsanleihen aus. Ihr Zweck besteht nicht darin, das staatliche Geld für künftige Ausgaben zu „beschaffen“, sondern darin, überschüssiges Basisgeld aus dem Finanzsystem zu binden. Es handelt sich also nicht um eine Finanzierungsnotwendigkeit, sondern um eine geldpolitische Maßnahme: Banken oder andere Akteure, die zuvor zusätzliches Basisgeld erhalten haben, können dieses nun gegen verzinsliche Staatsanleihen tauschen.
Am Ende dieses Prozesses stehen zwei Ergebnisse: Im Finanzsystem befindet sich eine zusätzliche Staatsanleihe – und im Privatsektor mehr Geldvermögen. Das Geld, mit dem die Anleihe bezahlt wurde, wurde durch frühere Staatsausgaben geschaffen. Der Staat leiht sich kein Geld, er schöpft es.
Inflation: reale Grenzen statt buchhalterischer Disziplin
Dass der Staat über Währungshoheit und die Fähigkeit zur Schöpfung von Basisgeld verfügt, bedeutet nicht, dass staatliche Ausgaben unbegrenzt möglich wären. Die relevanten Grenzen ergeben sich nicht aus buchhalterischen Vorgaben, sondern aus den realwirtschaftlichen Kapazitäten der Volkswirtschaft.
Inflation entsteht dann, wenn zahlungsfähige Nachfrage auf ein begrenztes Angebot trifft – sei es aufgrund von Vollbeschäftigung, Produktionsengpässen oder importbedingten Kostensteigerungen. Maßgeblich ist, ob inländische Produktionsmittel – insbesondere Arbeitskraft – noch ungenutzt sind. Solange dies der Fall ist, können zusätzliche staatliche Ausgaben Beschäftigung und reale Wertschöpfung erhöhen, ohne Inflationsdruck zu erzeugen. Solange keine Vollbeschäftigung herrscht, also potentielle Beschäftigung brach liegt, kann der Staat durch Defizitausgaben weitere Beschäftigung anregen und damit die Produktion und nicht die Preise erhöhen.
Paul Davidson hat diesen Zusammenhang im Kontext der Post-Keynesianischen Theorie prägnant beschrieben: In einer Situation, in der private Haushalte und Unternehmen aufgrund von Sparneigung mehr Arbeitsstunden anbieten, als sie selbst nachfragen, entsteht eine strukturelle Nachfrage- und Beschäftigungslücke. Um unter diesen Bedingungen Vollbeschäftigung zu erreichen, bedarf es zusätzlicher staatlicher Nachfrage – das heißt: der Staat muss in dem Umfang Defizite finanzieren, der den aggregierten Sparwünschen des Privatsektors entspricht. Er muss die Arbeitsstunden direkt oder indirekt kaufen, die die private Wirtschaft zwar anbietet, aber nicht selbst nachfragt.
Da private Haushalte und Unternehmen in den großen kapitalistischen Volkswirtschaften seit über zwei Jahrzenten eine ausgeprägte Tendenz zur Schuldenrückzahlung und Ersparnisbildung zeigen, ist in diesen Ökonomien die interne Nachfrage nach Arbeitsstunden deutlich zu niedrig, um Vollbeschäftigung zu erreichen. Daraus folgt: Es bedarf permanenter staatlicher Defizite, um diese Nachfrage- und Beschäftigungslücke zu schließen und die gewünschte gesamtwirtschaftliche Stabilität zu erreichen.
Einige ältere Vertreter der post-keynesianischen Tradition hegen möglicherweise noch die Hoffnung, durch geeignete Anreize eine substanzielle Belebung privater Unternehmensinvestitionen zu erreichen, sodass der private Sektor von sich aus wieder mehr Arbeitsstunden nachfragt. Doch solche Vorstellungen sind zunehmend historisch zu verorten. Angesichts der gegenwärtigen strukturellen Sparüberschüsse bedarf es vor allem einer pragmatischen und realitätsnahen Problemlösung, die auf die tatsächlich bestehenden Nachfragebedingungen und Investitionshemmnisse eingeht. Für junge Ökonomen handelt es sich bei sparenden Unternehmen nicht um eine „neue Welt“, sondern um einen Normalzustand.
Steuern: Ordnungsfunktion statt Finanzierungsquelle
Steuern erfüllen mehrere Funktionen. Sie sichern die allgemeine Akzeptanz des staatlichen Geldes, sie begrenzen gesamtwirtschaftliche Nachfrage, sie steuern Verhalten und fördern Verteilungsgerechtigkeit. Was sie jedoch nicht tun: Ausgaben finanzieren.
Dass Steuern in staatlichem Basisgeld bezahlt werden müssen, erzeugt eine Grundnachfrage nach diesem Geld. Die Steuerpflichtigen versuchen daher, entweder direkt oder indirekt an Basisgeld zu gelangen – was typischerweise über den Erhalt von Bankeinlagen erfolgt, die wiederum aus staatlichen Ausgaben oder anderen Transaktionen mit Basisgeld gedeckt sind. Bankgeld erhält wiederum eine sichere Nachfrage, da private Kredite zurückgezahlt werden müssen.
Demokratisch betrachtet heißt das: Über staatliche Ausgaben sollte anhand realer und gesellschaftlicher Ziele entschieden werden – Beschäftigung, Gesundheit, Bildung, Ökologie. Steuerpolitik wiederum sollte sich an ihren ordnungspolitischen Funktionen orientieren – nicht an einem vermeintlichen Finanzierungsbedarf.
Politische Bedeutung monetärer Souveränität
Eine Geldordnung, die diese Zusammenhänge anerkennt, erweitert den politischen Handlungsspielraum erheblich. Sie verpflichtet zur realwirtschaftlichen Verantwortung, nicht zu buchhalterischer Selbstbeschränkung.
Staatliche Defizite sind kein moralisches Problem, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit, wenn der private Sektor netto sparen will. Ziel ist nicht ein formal ausgeglichener Haushalt, sondern eine ausgeglichene Volkswirtschaft mit hoher Beschäftigung, stabilen Preisen und funktionierender Infrastruktur.
Die Verweigerung staatlicher Ausgaben bei Arbeitslosigkeit, Bildungsnotstand oder ökologischer Krise ist dann nicht „solide Politik“, sondern politisch gesetzte Ressourcenverschwendung.
Fazit
Wer nicht proaktiv staatliche Defizite steuert, riskiert, die Volkswirtschaft in eine Rezession zu treiben. Denn wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ausbleibt, sinkt die private Investitionsbereitschaft, es kommt zu steigender Arbeitslosigkeit – und in der Folge steigen die automatischen Sozialausgaben, während die Steuereinnahmen zurückgehen. Zu Defiziten kommt es dann ohnehin – nur unkontrolliert und krisenbedingt.
Die zentrale Frage ist also nicht, ob es zu Staatsdefiziten kommt, sondern wie klug oder unklug diese gestaltet sind. Vorausschauende und zielgerichtete Ausgabenpolitik nutzt die Fähigkeit des Staates, Geld zu schöpfen und Nachfrage zu stabilisieren, um Arbeitslosigkeit und Krisendynamik zu verhindern. Wer sich dagegen auf vermeintlich „solide“ Sparpolitik zurückzieht, handelt letztlich wirtschaftlich und gesellschaftlich kontraproduktiv.
Ein Blick auf die aktuelle Wirtschaftspolitik zeigt ein grundlegendes Missverständnis makroökonomischer Zusammenhänge. In einer Situation steigender Arbeitslosigkeit und schwacher Nachfrage verfolgt die Regierung Maßnahmen, die darauf abzielen, das Arbeitsangebot weiter zu erhöhen: Erhöhung der Wochenarbeitszeit, Anhebung des Renteneintrittsalters. Immer mehr Menschen sollen also Arbeit anbieten – in einem Umfeld, in dem bereits vorhandenes Arbeitsangebot nicht vollständig nachgefragt wird und immer weiter steigt.
Kurz: die Regierung weigert sich, weitere Arbeit zu kaufen, will aber, dass mehr gearbeitet wird. Sie baut die zu lange Seite, das Angebot, weiter aus und die Nachfrage nach Arbeit zu verbessern. Nach schulischer Bewertung wäre das eine glatte Sechs.
Kontakt: mmtmitjan@gmx.de
YouTube: https://www.youtube.com/@mmtmitjan209
X: https://x.com/MoosFrederik
Licensed under EE Originals