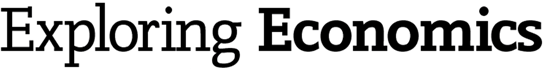Eine plurale Sicht des (Wohnungs)marktes
Universität Siegen, 2018
Dieser Text ist ein Auszug aus der Studie „Eine kritische Analyse an deutschen Hochschulen vorherrschender Einführungen in die Mikro- und Makroökonomie und plural-heterodoxe Alternativlehrbücher“ von Helge Peukert und Christian Rebhan. In dieser Studie werden vorherrschende mikro- und makroökonomische Lehrbücher an deutschen Hochschulen anhand der exemplarischen Beispiele der Einführungen Varians und Blanchard/Illings texthermeneutisch und nach vorheriger Entwicklung eines Kriterienkatalogs zum Mainstream und zur Heterodoxie untersucht.
Ergebnisse der Studie auf einen Blick:
- Vor allem die mikroökonomischen Lehrbücher stellen einseitig die positiven Wohlfahrtseffekte der im Kern stabilen „Konkurrenzwirtschaft“ in den Mittelpunkt.
- Ungleichheit, ökologische und sozialpolitische Aspekte spielen kaum eine Rolle, staatliche Wirtschaftspolitik und z.B. die gewerkschaftliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer werden einseitig negativ behandelt.
- Auch nach der Finanzkrise wird ein Ansatz eher effizienter Finanzmärkte vertreten. Entsprechend zurückhaltend fallen die Reformvorschläge aus.
- Die Studierenden lernen nur sehr wenige und ziemlich marktfreundliche Denkschulen kennen. Ökologische, postkeynesianische, sozioökonomische u.a. Ansätze werden nicht einbezogen.
Eine plurale Sicht des (Wohnungs)marktes: Der „ideale Markt“ in Hal Varians „Grundzüge der Mikroökonomik“ und Alternativen
Hal Varian brachte im Jahr 1978 sein erstes mikroökonomisches Lehrbuch heraus, nachdem er 1969 am MIT mit einem Bachelor of Science, 1973 mit einem Master in Mathematik und dann mit einem PhD in Ökonomie an der University of California (Berkeley) abschloss, an der er nach einigen anderen Stationen auch bis zu seiner Emeritierung lehrte. Der US-amerikanische Ökonom befasst(e) sich schwerpunktmäßig mit Wohlfahrts- und Informationsökonomie und mit Gerechtigkeitstheorien.
Seit 2002 war er als Berater (Consultant) bei Google für Ökonometrie, Finanzwesen, Unternehmensstrategie und Öffentlichkeitspolitik tätig. Seit 2007 ist er Chefökonom bei Google. Das Unternehmen wird im Vorwort gleich zweimal erwähnt (Varian 2016, S. XXVI, Varian wird im Folgenden mit V abgekürzt). Auf seine „Neben“Tätigkeit wird im Lehrbuch nicht hingewiesen, nur auf dem Buchrücken und erst seit der hier untersuchten 9. Auflage aus dem Jahr 2016 findet sich diese Angabe in seiner Kurzbiographie (zu seiner erheblichen und problematischen Rolle bei Google siehe Matthias Hohensee unter http://www.wiwo.de/politik/ausland/die-meisterfluesterer-der-chefoekonom-von-google/11805456.html). Diese späte und nur auf dem Buchrücken angezeigte Aktivität als Chefökonom Googles entspricht nicht unbedingt den von der American Economic Association beschlossenen ethischen Standards für Ökonom_innen (siehe http://blogs.reuters.com/macroscope/2012/01/06/new-ethics-standards-for-economists/).
Varian kann keinesfalls als interessenkonfliktfreier, (wert)neutraler Wissenschaftler angesehen werden. Es sei darauf hingewiesen, dass englischsprachige LB, v.a. für den amerikanischen Markt bestimmte, für oft multinationale Verlage und Autoren eine gewinnträchtige Unternehmung darstellen, bei der es um Millionen gehen kann und ständig leicht veränderte, neue Auflagen der LB zu exorbitant hohen Preisen erscheinen (siehe zum ausgefeilten System der Ausbeutung der Studierenden, das noch nicht in Deutschland angekommen ist Peukert 2018a, S. 57-59).
Hiermit mag es zusammenhängen, dass die Verfasser und Herausgeber des LB wissenschaftliche Präzision und Sorgfaltspflicht vermissen lassen, um Geld zu sparen: Eine einheitliche Zitierweise gibt es nicht, gleich beim ersten Titel (nach mehreren hundert Seiten, siehe V, S. 647, Fn. 1) werden die Herausgeber als alleinige Autoren angezeigt, Kahneman wird manchmal falsch geschrieben (V, S. 649, Fn. 3), die Seitenzahlen der Literaturangaben (V, S. 651, Fn. 6: 150-162 ist richtig und 661, Fn. 17: 122-130 ist richtig), oder der Jahrgang stimmen öfters nicht (V, S. 651, Fn. 6: 27 ist richtig), oder Volume und Seite fehlen völlig (V, S. 651, Fn. 7 und 653, Fn. 9). Artikel, die auch in Zeitschriften erschienen, werden als Working Paper zitiert (V, S. 652, Fn. 8: erschienen im Journal of Finance und 654, Fn. 11: erschienen im American Economic Review) oder das Jahr fehlt und der Beitrag wird nicht nach der Veröffentlichung in einem Journal zitiert (V, S. 660, Fn. 15: 2007 im Journal of Economic Behavior and Organization erschienen).
Das Vorwort des LB von Varian enthält eine einzige Botschaft: Der Autor befürwortet einen „analytischen Ansatz“ und eine „streng logische Argumentation“. Er beklagt mehrfach den Mangel an mathematischen Vorkenntnissen bei den Studenten, sie „sollten die Differentialrechnung beherrschen, aber sie können sie nicht“ (V, S. XXIII). Mit Mathematik seien Gedankengänge „viel einfacher darstellbar, und alle Studierende der Volkswirtschaftslehre sollten das erkennen“ (V, S. XXIV). Er fordert, „(a)lle Studierenden der Volkswirtschaftslehre sollten fähig sein, eine ökonomische Geschichte in eine Gleichung oder ein Zahlenbeispiel zu übersetzen“ (V, S. XXIV, M11). Dementsprechend lassen sich die Trainingsbücher bereits vorab sehr leicht zusammenfassen: Es wird nur gezeichnet und gerechnet. Ganz leicht macht Varian es den Studierenden aber auch nicht unbedingt. So bleiben gelegentlich Annahmen unerwähnt (bei der Berechnung auf V, S. 288-289 wird z.B. vorausgesetzt, dass P2 = 1 ist). Hinweise auf Übereinstimmungen mit den 11 Charakteristika erfolgen im weiteren Verlauf wie im vorletzten Satz in Kurzform durch Einfügungen von M1 bis M11, NK steht für die angeführten gemeinsamen Elemente der Neoklassik.
Dass es Fragestellungen und Phänomene geben kann, die sich nicht in Zahlen und einem berechenbaren Modell ausdrücken lassen, kommt dem Autor nicht in den Sinn. Er kritisiert ausdrücklich LB im Stile von Pindyck/Rubinfeld (2015): „In den meisten Lehrbüchern sehen die Studienreden eine Menge Graphiken mit sich verschiebenden Kurven, aber sie werden wenig mit Algebra oder Berechnungen konfrontiert […] Graphiken können Verständnis bewirken, aber der wahre Wert ökonomischer Analyse liegt in der Berechnung quantitativer Antworten zu ökonomischen Fragestellungen“ (V, S. XXIV).
Deutlicher kann man sich nicht für einen monistischen, formalen, modelltheoretisch-ökonometrischen Ansatz aussprechen. Es überrascht schon, dass dieser Aspekt der einzige Inhalt des Vorwortes ist, in dem er der Mikroökonomie eine primär lösungsorientierte Aufgabe zuspricht. Es finden sich keine Aussagen über inhaltliche oder substantielle Aspekte der Mikroökonomie, mit denen man die Studierenden ggf. für das Fach begeistern könnte. So spricht er sich für möglichst algebraische Darstellungen aus, denn „(z)ur Lösung praktischer Probleme wird […] Algebra verwendet“ (V, S. XXIV). Es wird sich zeigen, was aus diesem Anspruch für seine Darlegung folgt und ob z.B. Einseitigkeiten der Konsum- und Produktionstheorie vermieden und ob empirisch gehaltvolle Analysen und Beispiele geboten werden.
Ohne mathematischen Anhang und Antworten ist die 9. Auflage mit mathematischem Anhang und den Antworten auf 876 Seiten angeschwollen. Viele neue Beispiele wurden im Laufe der Auflagen eingefügt und der Spieltheorie, die bereits in der 1. Auflage mit wenigen Seiten behandelt wurde, seit der 6. Auflage (2004) breiter Raum zugesprochen (zu ihren konzeptionellen Grenzen siehe Rizvi 1994). Auch kamen seit der 5. Auflage (2001) neue Kapitel zu Auktionen und Informationstechnologie hinzu, die hier unberücksichtigt bleiben (siehe Peukert 2018a, Kapitel 2). Vorab sei bemerkt, dass die Finanzkrise praktisch spurlos am LB vorüberging, nur wenige, kaum selbstreflexive Bemerkungen wie die Kurzbeschreibung von Value-at-Risk seit der 8. Auflage (2011, S. 273) wurden aufgenommen.
Den Kern des LB stellen folgende Themen dar: Budget, Präferenzen, Nutzen, Entscheidung, Nachfrage, Konsumentenrente, Marktnachfrage, Gleichgewicht, Tausch, Gewinnmaximierung, Technologie, Kostenminimierung, Kostenkurven, Unternehmens- und Branchenangebot, Monopol, externe Effekte und öffentliche Güter. Dies entspricht bereits auf den ersten Blick vollständig den Leeschen Kriterien (Lee 2010, S. 205-206), obwohl die Überschrift zu seiner Kapitelübersicht „Viele Wege führen zu ökonomischer Erkenntnis“ (V, S. XXV) lautet. Zwei Kapitel wurden in der Übersicht vergessen, das neue Kapitel 17 über Messung und Kapitel 31 über Verhaltensökonomie.
Zur freien Wahl in Vorlesungen werden u.a. die Kapitel über Monopolverhalten, Oligopole sowie asymmetrische Informationen gestellt (V, S. XXV). Es überrascht, dass z.B. das Kapitel zu Oligopolen nicht zu den Kernmodulen gehört, die monopolistische Konkurrenz auf sehr wenigen Seiten in einem dazu nicht zum Kernkanon zählenden Kapitel abgehandelt wird (V, 548-552), so dass es auf die Unterscheidung Monopol versus „Konkurrenzmärkte“ hinausläuft. Faktormärkte werden dem üblicherweise in Vorlesungen nicht behandelten Teil zugeschlagen.
Der ideale Markt
Auf 20 Seiten wird in Kapitel 1 „Der Markt“ anhand eines Wohnungsmarktes erläutert. Es soll nur einen raschen Überblick bieten. Das Kapitel gehört etwas überraschend zu den Wahlkapiteln und nicht zum Kernbestand. Wird es als nicht zu den Kernmodulen gehörend übersprungen, beginnt die Mikroökonomie in Kapitel 2 mit den formalen Bestimmungen der Budgetbeschränkung (siehe unten). Jenseits aller wissenschaftstheoretischer Debatten und Erkenntnisse über die zwangsläufig selektive und von den Fragestellungen und vorwissenschaftlichen Annahmen über den Gegenstandsbereich abhängigen Ausformulierungen von Modellen wird in selbstbewusster Naivität festgestellt: „Die Bedeutung eines Modells liegt im Weglassen irrelevanter Einzelheiten, was der Volkswirtin erlaubt, sich auf das Wesentliche der ökonomischen Wirklichkeit zu konzentrieren, die sie zu verstehen sucht“ (V, S. 1; Varian verwendet fast immer die weibliche Form).
Was aber ist das Wesentliche der ökonomischen Wirklichkeit? Aus der Ideengeschichte des ökonomischen Denkens kann man zumindest lernen, dass es hierüber recht unterschiedliche Meinungen gab und gibt (als Belege siehe Zamagni 1987, Kapitel 1). Varian scheint hier von einem objektiven, nur an Wahrheitssuche orientierten Wissenschaftler auszugehen, allerdings hatte er im Vorwort die Aufgabe der Mikroökonomie darin gesehen, praktische Probleme zu lösen. Objektive Wesenserkenntnis und praktische Verwertbarkeit scheinen sich parallel entwickeln zu können. Ist wohl das Wesentliche aus Sicht des Chefökonomen von Google identisch mit dem, was ein Ökonom, der die Verteilungsungleichheit ins Zentrum seiner Forschung stellt, für wesentlich hält?
Der Folgesatz zum obigen Zitat lautet: „Da uns interessiert, was den Preis von Wohnungen bestimmt, brauchen wir eine vereinfachte Beschreibung des Wohnungsmarktes […] Im Allgemeinen wollen wir das einfachste Modell heranziehen, das die untersuchte ökonomische Situation beschreiben kann“ (V, S. 1; M11). Es könnte aber auch etwas ganz Anderes interessieren, z.B., was zu tun wäre, um allen Studierenden preisgünstige Wohnungen zu gewährleisten. Warum sollte die Preisbestimmung von Wohnungen (M4) die natürliche, allerwichtigste Fragestellung sein, die sich wie von selbst aufdrängt?
Der Autor beschwichtigt, man könne später Komplikationen hinzufügen, um das Modell realistischer auszugestalten. Aber es wird sich noch zeigen, dass durch die Ausgangsfragstellung das Elementarmodell eine inhaltlich eine ganz bestimmte, nicht (wert)neutrale Richtung einschlägt.
Ausgegangen wird im Beispiel von einem Wohnungsmarkt einer mittelgroßen Universitätsstadt im amerikanischen Mittelwesten. Die präzise, eigentlich unwichtige Lokalisierung suggeriert Realitätsnähe. Es gibt zwei (Thünen)Kreise: Wohnungen in unmittelbarer Umgebung der Universität und solche im zweiten, entfernteren Kreis, die billiger sind und wo alle weniger zahlungsbereiten Studenten unterkommen können.
Diese Annahme ist nicht trivial. Gäbe es den äußeren Kreis nicht, könnten dort mangels Zahlungsfähigkeit einige Studierende trotz Zulassung gar nicht studieren. Dann würde sich eigentlich für einen „Gerechtigkeitsforscher“ wie Varian die Frage stellen müssen, wie man diesen Missstand, z.B. durch Wohnungsbau, beheben kann. Die finanziellen Ausgangsausstattungen der Studierenden rückten dann zwangsläufig ins Blickfeld. Wahrscheinlich müssten viele Studierende sehr weite Fahrtwege in Kauf nehmen, vom Studium abhaltende Nebenjobs annehmen und/oder in sehr kleinen Zimmern, eventuell zu mehreren wohnen (diese Problematik wird z.B. bei Frank/Bernanke 2009, S. 73 aufgegriffen).
In Varians Modell besteht kein Wohnungsproblem, da man zur Uni vom äußeren Ring aus „entweder mit dem Bus oder mit dem Rad fahren“ (V, S. 2) kann. Dank der nunmehr nicht mehr ganz beliebig und unschuldig erscheinenden Annahme einer mittelgroßen Unistadt im Mittelwesten kommen die eben erwähnten Probleme in dieser Form dank der Konstruktion des Fallbeispiels nicht auf.
Was „uns“ als Ökonom_innen selbstverständlicher Weise in erster Linie interessiert sei die Frage, was den Preis im inneren Ring bestimmt (V, S. 2; M4). Vor der Beantwortung werden noch einige Zusatzannahmen eingestreut. Es wird im Modell z.B. angenommen, dass alle Wohnungen außer ihrer Lage gleich sind. Es besteht also implizit vollkommene Information auf Seiten der Nachfrager, so dass die Stiglitzschen Informationsasymmetrien (Stiglitz 2002) und ihre Folgen für die Beurteilung von reinen Marktlösungen ausgeschlossen sind. Nähme man eine gewisse Produktdifferenzierung hinsichtlich der Qualität der Wohnungen an, käme eher ein Modell monopolistischer Konkurrenz heraus. Würde man Suchkosten einbeziehen, könnte auf einem angespannten Wohnungsmarkt trotz vieler Anbieter auch der Monopolpreis resultieren (zum Belege siehe Hill/Myatt 2010, S. 55 und Keen 2011, S. 55).
Implizit wird auch auf der Angebotsseite ein vollkommener Konkurrenzmarkt vorausgesetzt, von dem aber meist eher unbestimmt als „dem Markt für innere Wohnungen“ die Rede ist, dessen (Einheits)Preis „durch Kräfte bestimmt wird, die im Modell beschrieben werden“ (V, S. 2). Diese noch zu beschreibenden Kräfte setzen die Annahmen der vollkommenen Konkurrenz voraus. Obwohl sie hinsichtlich Realitätsgehalt ein Grenzfall ist, wird sie dennoch bei der Beurteilung wirtschaftlicher Phänomene und anderer Marktformen in LB meist als Vergleichspunkt hinsichtlich allokativer und produktiver Effizienz herangezogen. An dieser Stelle nur darauf hingewiesen werden, dass eine Vielzahl an Annahmen getroffen werden müssen (homogenen Güter, vollständige Markttransparenz, mengen- und nicht preisanpassende Unternehmen usw.), um formal sauber von vollständigem Wettbewerb zu sprechen, gerade weil Varian diese Voraussetzungen nicht alle explizit aufführt (siehe Bumas 1999, Kapitel 7 und Peukert 2018a, S. 66-67; NK, M1 ,2, 4, 5a, 6, 7, 10 und 11).
Als Rahmen der Analyse wird ohne jegliche nähere Begründung das Optimierungs- und das Gleichgewichtsprinzip eingeführt, die meistens in der VWL verwendet würden (M2). Das Optimierungsprinzip sei fast tautologisch und verstehe sich eigentlich von selbst, denn Menschen wählten natürlich die für sie besten Konsummuster. In diesem Modell erscheint die an sich sehr voraussetzungsvolle Annahme bewusster Optimierung tatsächlich aber auch nur deshalb trivial, weil es nur die zwei Preise des äußeren und inneren Ringes des homogenen Gutes „Wohnraum“ gibt. Das Gleichgewichtsprinzip sei ein wenig problematisches, demgemäß sich die Preise so lange anpassen, bis die nachgefragte Menge gleich der angebotenen Menge sei (V, S. 3; siehe hierzu die Kritik von Gräbner 2016).
Gedanklich setzt dies eigentlich anfängliche Tauschprozesse zu Ungleichgewichtspreisen voraus, was im Angebots-Nachfrage-Schaubild dann aber ausgeschlossen wird (M4). Varian wählt hier den implizit den Walrasianischen Ansatz des competitive trading, bei dem ein ideeller Marktwächter oder Auktionator vor Produktions- und Tauschbeginn so lange die Preise und Mengen ausruft und abstimmen lässt, bis sich markträumende Preise ergeben. Auf wenigen Märkten wie dem Aktienmarkt gibt es tatsächlich ein solches Verfahren. Dem stehen Edgeworthsche negotiated transactions, d.h. Tauschvorgänge auch zu Ungleichgewichtspreisen gegenüber, bei denen Tausch gesehen wird „as a kind of game in which agents present themselves with a certain quantity of goods and the objective of achieving a maximum personal gain. There is no fixed price mechanism at work here. Rather, agents look around to find those agreements which most afford them the most convenient exchanges“ (Zamagni 1987, S. 96).
Wie selbstverständlich wird bei Varian das competitive trading-Modell unterstellt, obwohl im realen Wirtschaftsleben negotiated transactions vorherrschen dürften. Bei ihnen ändern sich mit jeder Transaktion die individuellen Ausstattungen, auch die Verteilung variiert kontinuierlich, was nicht mit der einfachen Methode der komparativen statischen Partialanalyse nicht darstellbar ist und zudem zu keinem aus den Angeboten und Nachfragen eindeutig ableitbaren Gleichgewichtspunkt führt, sondern vom historischen Entwicklungspfad der Tauschvorgänge abhängt. Erst etwas später wird beiläufig präzisiert, dass wir es mit „vielen unabhängigen Vermietern“ zu tun haben; andere Marktformen seien sicherlich möglich (V, S. 6).
Zamagni erläutert den Unterschied zwischen Walras´ und Marshalls Ansatz (1987, S. 102-106). Bei Marshall erfolgen die Anpassungsprozesse wesentlich über Mengenanpassungen und nicht alle Akteure sind Preisnehmer, was zu unterschiedlichen Beurteilungen von Gleichgewichten als stabilen oder instabilen führen kann. Zamagni weist auch auf die Bedeutung von Erwartungen hin, um den sehr mechanischen Charakter der bisherigen Gleichgewichtsanalyse etwas zu überwinden. Neben dem Spinnwebtheorem führt er als Annäherung an reale Vorgänge auch Hicks´ Konzept der Elastizität der Erwartungen an: Steigt der Preis eines Gutes, und die Erwartungen sind unelastisch, so werden Spekulanten die Preiserhöhung für ein temporäres Phänomen halten. Dann werden diese Käufer versuchen, ihre Käufe zu verschieben, bis der Preis wieder zum vorherigen Niveau sinken wird. Die Produzenten werden ihre Angebote erhöhen. Auf diese Weise stabilisiert sich der Markt(preis). Anders verhält es sich bei elastischen Erwartungen: In diesem Fall werden die Käufe in Erwartung weiterer und dauerhaft steigender Preise erhöht und die Verkäufer rationieren ihre Angebote, so dass die Preise in Übereinstimmung mit den Erwartungen weiter steigen werden. Es ergeben sich dann starke Preisfluktuationen (1987, S. 111-112).
Schließlich führt Zamagni noch die Unterscheidung von reinen flow und stock markets an (1987, S. 112-113). Bei Letzteren kommen Lagerbestände vor, um temporäre Unterschiede zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen, aber auch, um Spekulation zu betreiben. Varian nimmt stets Markträumung an, Spekulation wird konzeptionell von vornherein ausgeschlossen. Man darf sich dann nicht wundern, wenn die Studierenden später dank einer solchen normallfallbedingten déformation professionelle wenig Sensibilität für kritische Entwicklungen auf den Wohnungs- und (Finanz)Märkten entwickeln. Die angeführten Ergänzungen sollen andeuten, wie hochrestriktiv der Aufschlag Varians ausfällt, ohne dass dies für die Studierenden transparent wäre.
Diesen Einseitigkeiten kann eine weitere hinzugefügt werden. Gäbe es ein Konkurrenzmodell mit einer gewissen Marktmacht z.B. einer lokalen, privatwirtschaftlichen Wohnungsbauorganisation, sähe das Modell anders aus und würde als Gegenmacht eine eventuell politisch erzwungene zentrale Vermittlung der Wohnungen durch die Universität nahelegen, die mit den Anbieteroligopolen oder Monopolen verhandelt, um niedrigere Preise durchzusetzen. Nur aufgrund der getroffenen Annahmen kann auch zur Exemplifizierung der komparativen Statik das Resultat erzielt werden, dass die Erhebung einer Wohnungssteuer weder Angebot, noch Nachfrage oder den Gleichgewichtspreis in der kurzen Frist verändern (V, S. 9-12; M5).
Dieses Ergebnis hängt vollständig von den getroffenen, restriktiven Annahmen ab, die demnach nicht nur gut gemeinte didaktische Vereinfachungen darstellen. Es ist in gewisser Weise kontraintuitiv und stellt im ganzen Kapitel wohl das einzige auf den ersten Blick überraschende Ergebnis des Modells vor. Es ist erwähnenswert, dass der Staat hier nur als externer, Steuern erhebender Störfaktor (M5) vorkommt und z.B. legislative Maßnahmen zur Verringerung der Wohnungsproblematik (z.B. eine vorgeschriebene Quote für Sozialwohnungen bei Neubauten wie in München) als raffiniertere Steuerungsmaßnahmen der zweiten Generation nicht vorkommen.
Insgesamt liegt ansonsten bei Varian ein völlig institutionenfreies Marktgeschehen vor, das konsequent, außer in den letzten Kapiteln über externe Effekte und öffentliche Güter (ab Kapitel 35), scheinbar ohne jegliche nötige Rahmengesetzgebung auszukommen scheint. Ein früheres Auftauchen ist angesichts der Modellannahmen auch gar nicht nötig, da dank der unterstellten Gleichgewichtstendenz „die Handlungen der ökonomischen Akteure miteinander konsistent sind“ (V, S. 3). Hierbei interessiert laut der Aussage an gleicher Stelle nur der Gleichgewichtspreis, „nicht jedoch, wie der Markt zu diesem Gleichgewicht kommt“ (V, S. 3). Aber durch die im LB folgende Darstellung des Gleichgewichtspreises anhand des Angebots- und Nachfrageschemas wird doch eine für alle benevolente und nicht verbesserbare Dynamik durch das automatisch-mechanische Wirken der Marktkräfte auf einem atomisierten Markt nahegelegt (M4 und M11).
Demgegenüber ist entgegen dem optischen Eindruck unzweifelhafter Schnittpunkte der Kurven festzuhalten: Ein „Diagramm selbst ist nicht geeignet, irgend etwas zu beweisen, sondern nur Worte zu sparen. Selbst so muß es mit Vorsicht gebraucht werden“ (Robinson/Eatwell 1980, S. 234). Unter anderem deshalb, weil es tatsächliche dynamische Anpassungsprozesse auf eine mechanische Analogie verkürzt, denn
„wenn die Zeit in die Beweisführung eingeführt wird, was bedeuten dann die Kurven? Wenn der Preis heute OP1 ist [das Angebot ist größer als die Nachfrage], würde die gekaufte Menge nicht die gleiche sein, falls die Käufer wüßten, daß eine Preissenkung erwartet wird, als sie sie es sein würde, wenn sie von der langen Erfahrung seiner Konstanz ausgingen […] Darüber hinaus ist die Idee der Vorwärtstendenz auf eine Position zu, die niemals tatsächlich erreicht wird, nicht leicht zu begreifen. Wie lange wird erwartet, werden die Bedingungen, die den Kurven zugrundeliegen, in Kraft bleiben, während der Markt schwankt? Werden nicht die Bewegungen selbst die Position beeinflussen, auf die sie sich zubewegen?“ (Robinson/Eatwell 1980, S. 234).
Durch die Ausklammerung der Dynamik entgeht man auch den z.B. bei Pindyck/Rubinfeld (2015, v.a. in den ersten Kapiteln) auftretenden Fallstricken, z.B. der Annahme der Preisnehmer und der Frage, wie und wer dann die Preise anpasst. Der Anspruch einer dynamisch-empirischen Analyse wird nicht erhoben, obwohl man alternative dynamische Anpassungsprozesse durchaus elementar in einem Angebots-Nachfrage-Schema darstellen kann (Cohn 2007, Kapitel 5). Aber eine Musteraussage trifft der Autor aus der hohlen Hand dennoch: Zwar könnten zu bestimmten Zeiten Angebot und Nachfrage nicht übereinstimmen und sogar das ganze System destabilisierende Entwicklungen auftreten: „Das alles kann passieren […] aber üblicherweise geschieht es nicht“ (V, S. 3). Vom Wohnungsmarkt einer mittelgroßen Unistadt im Mittelwesten der USA aus, die anscheinend nicht von der Subprime-Krise tangiert wurde, wird mutig auf allgemeine marktwirtschaftliche Gleichgewichtsprozesse generalisiert. Varian sieht sich nicht veranlasst, dieses harmonische Bild nach der amerikanischen Immobilienkrise seit 2007 auch nur minimal zu relativieren.
Es folgt die Ableitung der Nachfragekurve aus den Zahlungsbereitschaften der Studierenden bei einer kurzfristig vertikalen Angebotskurve. Auch wird unterstellt, dass man die zukünftigen Nutzen genau vorhersagen kann. Muss man sich z.B. zwischen dem Kauf eines Pianos und vielen Pizzas in der Zukunft entscheiden, so dürften hierfür die reale Einkommensentwicklung, Gesundheitsinformationen, der Konsum der relevanten Bezugsgruppe usw. eine Rolle; über all diese Einflussfaktoren müsste man vorab Bescheid wissen (siehe z.B. das Schaubild bei Bumas 1999, S. 94 zur binären Nachfrage).
Im LB kommt es auf jeden Fall zu einem Schnittpunkt und der Gleichgewichtspreis wird in der kurzen Frist durch die Vorbehaltspreise unter Voraussetzung eines fixen Angebots determiniert (M4). Das Endergebnis des Modells ist auch unter sozialen Gesichtspunkten erfreulich: Diejenigen mit geringer Zahlungsbereitschaft finden dank der Annahme Varians Wohnungen im äußeren Ring (dort könnten, wie erwähnt, als Alternativszenario, die Preise für Viele auch zu hoch sein). Der Gleichgewichtspreis erfreut alle (außer dem Grenznachfrager) auch insofern, als ihr Vorbehaltspreis über dem Gleichgewichtspreis liegt und die atomisierten Anbieter haben auch das für ihr Eigeninteresse maximale Ergebnis erzielt.
Der ideologische Gehalt dieses harmonischen Bildes, das so gar nicht der Situationsbeschreibung vieler Studierender nicht nur in den USA und in Deutschland entspricht, lässt sich auch am Begriff der Zahlungsbereitschaft der Nachfrager festmachen. Varian fragt nicht, warum einige Studierende viel Geld zu zahlen bereit sind und andere nicht (siehe auch V, S. 3 unten). Nur ganz am Anfang seines Beispiels bemerkt er, es „würden die meisten Studierenden eine nahegelegene Wohnung bevorzugen […] sofern sie sich eine leisten können“ (V, S. 2). Was später fehlt und durch den Begriff der Zahlungsbereitschaft überdeckt wird, ist der für viele Studierende wohl wesentliche Aspekt der (womöglich nicht vorhandenen) Zahlungsfähigkeit.
Der Begriff der Bereitschaft legt nahe, dass die Studierenden eine freie, nutzenmaximierende Entscheidung bei der Wahl des inneren oder äußeren Ringes treffen und nicht einfach budgetrestringiert sind (M1). Somit impliziert das begriffliche Framing auch eine bestimmte inhaltliche Tendenzaussage und blockiert kritische Fragen wie der, ob es denn gerecht ist, aus einkommensschwächeren Familien stammende Studierende hinsichtlich der Wohnungssituation zu benachteiligen oder ihnen sogar das Studium bei für sie zu hohen Preisen erheblich zu erschweren oder ganz zu verunmöglichen. Zamagni weist darauf hin, dass der Gleichgewichtsbegriff der LB zwei Definitionen des Gleichgewichts zusammenwirft, nämlich einmal als Ruheposition ohne inhärente Tendenz zu einer Veränderung und andererseits als Zustand, bei dem die Akteure ihre Pläne realisieren können und sich in Positionen befinden, in denen sie zu sein wünschen; dem equilibrium of rest steht eines als as a chosen position (gemäß Zahlungsbereitschaft) gegenüber. Bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit erreichen z.B. nach Keynes viele Akteure ihre erwünschte Position nicht, es kann dennoch ein stabiles Ruhegleichgewicht vorliegen (Zamagni 1987, S. 57).
Varian steigt ab der Überschrift „Andere Möglichkeiten der Allokation von Wohnungen“ auf seine Art in einen normativen Diskurs ein. Er unterscheidet die Fälle (1.) des diskriminierenden Monopols, bei dem dieselben Personen wie bei einem Konkurrenzmarkt die Wohnungen bekämen, nur in Höhe ihrer jeweiligen Zahlungsbereitschaft, (2.) des gewöhnlichen Monopols, bei dem nicht alle Wohnungen vermietet würden und (3.) eine Kontrolle der Mieten. Bei ihr ergibt sich eine Überschussnachfrage, bei der wohl nur (teilweise) andere Personen mit längerer Suchbereitschaft oder guten Bekannten in den inneren Ring kämen und Zahlungsbereite aus diesem in den äußeren Ring verdrängt würden. Die Frage einer eventuell sinnvollen, von der Zahlungsfähigkeit unabhängigen Zuteilung wird nicht thematisiert (M7). Man könne nur sagen, dass diejenigen, die eine Wohnung mit Mitpreisbremse haben, bessergestellt sind als im Fall eines Konkurrenzmarktes. Beim diskriminierenden Monopolisten stehe außer Frage, dass trotz der Belegung aller Wohnungen die Vermieter bestens und die Mieter schlechter gestellt seien.
Ohne nähere Begründung, warum man genau diese Sichtweise einzunehmen hat, brauche man eine Herangehensweise, bei der die ökonomische Position aller Mieter und Vermieter gleichzeitig zu vergleichen sei. Hier kommt das Prinzip der Pareto-Effizienz ins Spiel. „Wenn es eine Möglichkeit gibt, jemanden besser zu stellen, ohne jemand anderen zu benachteiligen - warum sollte man das nicht tun“ (V, S. 16)? Diese rhetorische Frage kann natürlich nur mit Ja beantwortet werden, es ist jedoch etwas ganz Anderes, sie zum vorrangigen oder alleinigen normativen Maßstab zu machen, nicht zuletzt deshalb, weil sich in der realen Welt kaum eine Maßnahme denken lässt, die nicht mindestens eine Person benachteiligt. In der praktischen Wirtschaftspolitik spielt das Pareto-Kriterium überhaupt keine Rolle. Auch im Fall des Vergleichs eines Konkurrenzmarktes, eines gewöhnlichen oder diskriminierenden Monopols oder einer Mietenkontrolle würde beim Übergang von einem zu einem anderen System keine Pareto-Verbesserung vorliegen können.
Daher muss Varian, der dem Pareto-Prinzip viele subtile Implikationen attestiert (V, S. 16), ein realitätsfernes Gedankenexperiment anstellen: Die Wohnungen werden zunächst im inneren und äußeren Ring per Zufallsprinzip zugewiesen. Es ist selbstverständlich, dass es bei Tauschmöglichkeit Studierende geben wird, die gegen eine Geldzahlung vom inneren in den äußeren Ring wechseln werden und insofern Tauschgewinne realisierbar sind. Varian schneidet somit die Frage einer gerechten Zuteilung auf den Modus freiwilliger, bilateraler Tauschprozesse zu. Dies macht überhaupt nur Sinn, wenn administrativ zugeteilte, von der Zusammensetzung her ineffiziente Ausgangsausstattungen wie beim Lieblingsbeispiel mit Gefängnisinsassen, die gleiche Mengen an Seife und Zigaretten bekommen und dann tauschen, vorausgesetzt werden.
Aus dem Beispiel der beliebigen Zuteilung plus Tauschmöglichkeit folgt im LB, dass am Ende des Prozesses die im inneren Kreis Wohnenden einen höheren Vorbehaltspreis haben als die Bewohner_innen des äußeren Kreises, da bei jeder anderen Zuteilung die Möglichkeit des Tausches bestünde. Eigentlich funktioniert das Beispiel nur, wenn man auch die gleiche finanzielle Ausgangsausstattung unterstellte, da es Menschen mit Gehbehinderung mit begrenztem Budget geben kann, die unbedingt im inneren Kreis wohnen müssten, aber das Pech hatten, im äußeren Kreis zu landen. Hier zeigt sich wieder die ideologische Komponente der Nichtberücksichtigung der Zahlungsfähigkeit, die Varian auch durch sein unrealistisches Beispiel der Verteilung per Zufallsprinzip umgeht.
So kommt er, ohne Erwähnung vieler notwendiger Annahmen, zum erwünschten Resultat: „Das Ergebnis eines Konkurrenzmarktes ist Pareto-effizient“ (V, S. 17). Auch beim diskriminierenden Monopolisten (wie z.B. Google?) sei das Ergebnis trotz verschiedener Einkommensverteilungen Pareto-effizient, da genau dieselben Leute eine Wohnung im inneren Ring haben werden wie bei vollkommener Konkurrenz.
Die Studierenden werden hier darauf vorbereitet, Verteilungsfragen als ökonomisch nur schwer handhabbare, normative Sekundärfragen zu behandeln und sich auf die „Effizienz des Tausches“ (V, S. 17) zu fokussieren, was impliziert, „freiwilligen“ Tauschvorgängen möglichst nichts in den Weg zu legen (M1). Hierbei wird, wie auch im Folgenden, immer unterstellt, „(a) transaction (or contract) is free and fair provided it was agreed to by all parties“ und nicht „(a) transaction (or contract) is free and fair provided all parties had viable alternatives to it and yet decided to go ahead with it“ (Varoufakis 1998, S. 179).
Beim Monopolisten seien aber Verbesserungen möglich, da er zu irgendeinem positiven Preis an jemanden eine weitere Wohnung vermieten könnte, der noch keine Wohnung hat, ohne sonst jemanden schlechter zu stellen. Es wird hierbei vorausgesetzt, dass er die Nachfrager diskriminierend behandeln kann. Relativ werden sich aber doch wohl all diejenigen schlechter gestellt sehen, die einen höheren Preis gezahlt haben. Auch müsste nach dieser Logik der Monopolist schließlich beim Preis des Konkurrenzgleichgewichts landen. Im konstruierten Fall ist natürlich die Mietkontrolle schlecht, da bei unterstellter Zufallszuteilung und nicht z.B. abhängig von der Bedürftigkeit sich sicher Personen finden werden, die gegen Bezahlung in den äußeren Ring umzögen.
Man könnte auch ein Modell konstruieren, bei dem es sich die Hälfte der Studierenden nicht leisten könnte, im inneren Ring zu wohnen. Ihnen würden die Wohnungen des inneren Rings zugeteilt mit Tauschoption. Das wäre auch Pareto-effizient und es ginge dann nur um die Zahlungsbereitschaft. Die Pareto-Effizienz ist an sich völlig verteilungsindifferent. „Wenn man alles einer Person gibt, wird dies typischerweise Pareto-effizient sein“ (V, S. 721; zu den ethischen Implikationen und Einseitigkeiten des Pareto-Kriteriums siehe Wight 2009, S. 53-58).
Auf wenigen Seiten hat Varian im ersten Kapitel seines LB in mustergültiger Stringenz das im ersten Kapitel unter M1-M11 beschriebene Mainstreamparadigma in allen Aspekten entfaltet. Gemäß der für den Mainstream aufgestellten 11 Kriterien steht das Beispiel eindeutig hinsichtlich der philosophischen Letztverankerung des Individualismus und persönlicher Eigentumsrechte und des wirtschaftspolitischen Grundcredos des Wirkens der unsichtbaren Hand am Beispiel des Wohnungsmarktes. Es geht in seinem Modellbeispiel um freiwillige Wahlhandlungen der wohnungssuchenden Studenten unter Knappheitsbedingungen (die Preise im inneren Ring). Die Akteure (Mieter und Vermieter) sind durch optimierend-rationales Interesse bestimmt.
Das Modell entspricht dem methodologischen Individualismus, da als bewegende Kräfte nur atomisierte Einzelpersonen auftreten und sich der Gleichgewichtspreis aus der Aggregation individueller Angebote und Nachfragen ergibt und ein partialanalytischer Ansatz gewählt wird. Beim Vergleich der Zuteilungsvarianten (Konkurrenzmarkt, diskriminierendes oder einfaches Monopol und Mietkontrolle) kommt es einzig auf allokative Effizienz anhand des Pareto-Kriteriums an. Da zur Ermittlung des Gleichgewichtspreises ein Marshallianisches Angebots- und Nachfragediagramm zum Zuge kommt, wird implizit eine Preis-/Angebots-/Nachfrage-Werttheorie angenommen. Es gilt insofern das Substitutionstheorem, als die Studierenden, die nicht im inneren Ring wohnen wollen oder können, im äußeren Ring unterkommen.
Varian behauptet, mit seinem Beispiel die Grundlogik von Marktprozessen zu erfassen, bereichsspezifische Eigenlogiken (z.B. Besonderheiten von Wohnungsmärkten oder des nichtreproduzierbaren Bodens) spielen keine Rolle. Jeder Studierende findet eine Wohnung, dank der Kräfte der unsichtbaren Hand und flexibler Preise findet eine Markträumung statt: Alle Wohnungen sind belegt, ohne Tränen von rationierten Studierenden, die keine Wohnung finden.
Das Gleichgewicht ist dem starken Mainstream I entsprechend ein stabiles und die Welt des Wohnungsmarktes abbildendes, reales Phänomen. Mietkontrollen als externe Eingriffe stören den spontanen Selbstanpassungsprozess von Angebot und Nachfrage, sie führen nur zu eher zufälligen Wohlfahrtsgewinnen Einiger und zu Wohlfahrtsverlusten Anderer und in jedem Fall zu einem Nettowohlfahrtsverlust. Varians Diskussion der Zuteilungsalternativen impliziert, dass die Wirkungen von Gestaltungsformen sich eindeutig ermitteln und rein ökonomisch und dank des Pareto-Kriteriums wertneutral beurteilen lassen (vergleiche Prasch 2003). Er befürwortet dem Mainstream I entsprechend eine Politik des Laissez-Faire.
Die Akteure seines Wohnungsmarktes haben keine beschränkte Rationalität, es gibt keine asymmetrischen Informationen oder unvollkommenen Wettbewerb. Er bringt in seinem Modell Tâtonnement und Recontracting (bei Zufallszuteilung) unter, in seinem Flexpreis-Modell sind alle Akteure Preisnehmer und es gilt die logische Zeit, d.h. die Anpassungsgeschwindigkeit ist am Anfang einer Vermietungsperiode sehr hoch. Die dynamischen Prozesse, die zum Gleichgewicht führen, sind unerheblich und unterliegen keiner Pfadabhängigkeit. Über sinnvolle institutionelle Ausgestaltungen der Wohnraumvermittlung braucht man sich keine Gedanken zu machen.
Ungleichheit, Armut und Macht kommen in der Unistadt im amerikanischen Mittelwesten nicht vor, die Studierenden handeln entsprechend ihrer Zahlungsbereitschaften, die Zahlungsfähigkeit und Studierende, die sich Wohnungen nicht leisten können, gibt es nicht. Geld (die Miete) dient als Tauschmittel. Der FIRE-Sektor und das Problem von Immobilienspekulation werden ausgeschlossen, stattdessen generalisierend behauptet: destabilisierende Marktprozesse passieren üblicherweise nicht (2016, S. 3).
Die natürliche Umwelt taucht im Modell nicht auf. Der Privatbesitz zu vermietender Wohnungen wird als selbstverständlich und insofern als natürliche Ordnung vorausgesetzt. Mit der Ermittlung des Gleichgewichtspreises anhand des Angebot-Nachfrage-Schemas und des unterstellt wertneutralen Pareto-Kriteriums kommt Ökonom_innen bei Varian die Rolle der vermeintlich unpolitischen Experten zu, die scheinbar über den Interessen der (Ver)Mieter stehen. Im Vorwort machte er unmissverständlich klar, dass ausgehend von einem linearen Fortschrittsgedanken der modeling approach mit zwangsläufig vielen Ceteris-Paribus-Annahmen und Mathematik als Hilfswissenschaft die einzige wissenschaftliche Basis für die VWL sein können.
Das Modell des Wohnungsmarktes entspricht insgesamt in seiner Anlage und Simplizität der Neoklassik vor Keynes. Hierbei erfolgt ein einseitiges, positives Framing des Marktes und der Konkurrenzwirtschaft.
„(A)lthough we may recognize the worth of the market as a social coordinator, we may also express our concern at the costs involved in the market´s achievement of this important result. For example, the market does little to guarantee what all would describe as a ´just´ distribution of resources and opportunities; it does not lead individuals to enjoy their jobs as much as we might wish. The market may encourage exasperated individualism which undermines social cohesion. It may not protect the weak. It may lead to conflict between workers and employers, or between lenders and borrowers. It may work in such a way as to lead to inflation or depression or it may function where we would wish there to be no market (the drugs and stolen goods markets) […] the division of labour […] is the cause of many problems and difficulties at both social and personal levels. We need to think of the alienation which develops from the exasperating repetitiveness of certain productive activities, the conflict which arises from the state of the relations in the factory and the problems which arise whenever specialization patterns change owing to technical inventions […]“ (Zamagni 1987, S. 61).
Weder in diesem einleitenden, noch in den weiteren Kapiteln ist von diesen Schattenseiten bzw. Reibungsflächen des Marktsystems auch nur entfernt die Rede.
Eine plurale Sicht des (Wohnungs)Marktes
Was folgt aus pluraler Sicht aus den hier vorgetragenen Kritikpunkten des Modells? Es kann nicht bestritten werden, dass es auf wie immer ausgestalteten Märkten Kräfte gibt, die unabhängig von den Intentionen der Akteure in bestimmte Richtungen drängen: Wenn die Anzahl Wohnungssuchender steigt, steigen ohne entgegenwirkende Tendenzen zumindest kurzfristig die Preise. Auch kann im Vergleich zu anderen Sozialwissenschaften wie der Soziologie nicht bezweifelt werden, dass das Denken in Modellen wie dem hier vorgestellten hilft, nicht über alles gleichzeitig nachzudenken und sich auf bestimmte Dinge unter Absehung vieler anderer Phänomene und Einflüsse zu konzentrieren.
Wie könnte das Anfangskapitel von Varian weniger einseitig aufgezogen werden? Das LB von Earl beginnt im ersten Kapitel auch mit einem Beispiel zur Wohnungspolitik. Die Frage lautet bei ihm: „Imagine a situation in which the government wishes to improve the access of the poor to housing. It only wishes to spend a limited sum in this area and wishes to do the best for those at whom its policy is aimed. Would you advise it (i) to use the money to subsidize rents, or (ii) to use the money to increase family income supplements to the poor?“ (Earl 1995, S. 51).
Wenngleich bei Varian noch nicht alle Bausteine zur Beantwortung dieser Frage vorgestellt wurden, so zeigt Earls Frage doch, dass man vermittels Optimierung mit Instrumenten aus dem Mainstreambaukasten auch eine ganz andere Blickrichtung, die des kompetent gestaltenden Staates einschlagen könnte. Earls Ausführungen weiten den Blick über die reine Optimallösung einer Geldzahlung hinaus, wenn er z.B. aus feministischer Sicht überlegt, ob eine Subvention nicht eventuell besser wäre, sofern die Männer den Geldzuschuss nur für ihren eigenen Privatkonsum usurpieren. Eine für Varians Beispiel modifizierte Wiederholungsfrage (V, S. 19-20) hätte zumindest ein Minimum an wirtschaftspolitischem Pluralismus eingebringen können. Earl stellt auch eine Frage zur Verringerung des Tabakkonsums (Earl 1995, S. 64-65), die auch die Grenzen des mikroökonomischen Instrumentariums bei bestimmten Fragestellung beleuchtet.
Im Vorgriff auf Varians folgende Ausführungen sei bemerkt, dass Earl auch einen realistischen alternativen Ansatz zum Konsumentenverhalten anbietet, der im Anschluss u.a. an Lancaster den Konsumenten als Produzenten in den Vordergrund stellt (1995, S. 52-61). In Kapitel 4 seines LB über „Behavioural perspectives on decision making“ (1995, S. 67-102) stellt er einen alternativen, dem realen Konsumverhalten entgegenkommenden Ansatz vor, der z.B. kompensatorische Heuristiken zur Bewältigung von (Über)Komplexität, und hybrid-kontingente Regeln, Framing, kognitive Dissonanzen, Zielkonflikte und viele Beispielfälle enthält, die sich bestens für eine plurale Ergänzung der mikroökonomischen Neoklassik eigneten.
Ein alternativer Vorschlag zu Varians idealtypischem Konkurrenzmodell könnte lauten, ein oder zwei Modelle hinzuzufügen, etwa durch Annahme von Angebotskonzentration, Rationierung oder ähnlichem, aus denen dann auch wirtschaftspolitisch konträre Folgerungen zu ziehen wären. Zusätzlich ließen sich die vielen möglichen Phänomene auflisten, die einer unsichtbaren Hand-Lösung à la Varian entgegenstehen, z.B. Suchkosten, Informationsasymmetrien usw. und die oben im Zitat von Zamagni (1987, S. 61) angesprochenen eventuell auftretenden Probleme. Man könnte die Studierenden ermuntern, die Einseitigkeiten des Modells von Varian aus der Sicht anderer Denkschulen zu kritisieren und alternative Modellgeschichten mit womöglich anderen wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen zu entwickeln.
So beginnt die Beschreibung der Marktökonomien bei Zamagni mit der Unterscheidung von Flex- und Fixpreis-Ökonomien oder Branchen, wobei bei letzteren „the principle of full cost is at work in the secondary and tertiary sectors (manufactures, services) […] which are exchanged in mono-oligopolistic markets“ (Zamagni 1987, S. 64-65). Entsprechende Postkeynesianische Ansätze und Preissetzungsverhalten gemäß dem Vollkostenprinzip und daraus ableitbare verteilungstheoretische Überlegungen werden im LB Varians mit keinem einzigen Wort erwähnt (siehe zu ihrer Erläuterung Zamagni 1987, Kapitel 12 und S. 468-470 und Earl 1995, S. 260-282).
Des Weiteren könnte man die tatsächlichen, sehr unterschiedlichen, institutionell-juridischen Einbettungen (Gürak 2012, Kapitel 10) z.B. des Wohnungsmarktes am Beispiel der USA und z.B. Deutschlands ansprechen und zeigen, dass solche Regeln sich nicht anhand des Pareto-Kriteriums aufstellen oder beurteilen lassen, sondern immer eine Abwägung von Interessenkonflikten (hier v.a. zwischen Mietern und Vermietern) sind und nicht im engeren Sinne ökonomische, sondern normative Entscheidungen verlangen (Commons 1924).
Schließlich könnte auch z.B. Anwar Shaiks an der ökonomischen Klassik orientierte, offene und realistische Konzept der real competition mit price-setting- und price-cutting-Verhalten innerhalb einer Branche an den Anfang gestellt werden, das ein längeres Zitat verdient. „Each individual capital operates under this imperative[s of profit and expansion], colliding with others trying to do the same, sometimes succeeding, sometimes just surviving, and sometimes failing altogether. This is real competition, antagonistic by nature and turbulent in operation. It is different from so-called perfect competition as war is from ballet. The mobility of capital is inherent in its existence. Capital tied up in labor, plant, equipment, and inventories is fixated and must be used up or sold off before it can adopt a new incarnation. But fresh money capital, borrowed or garnered as profit, always looks over the available list of avatars before making its choice. The profit motive rules in all cases […]
Competition within an industry forces individual producers to set prices with an eye on the market, just as it forces them continually to try to cut costs so that they can cut prices and expand market share. Cost-cutting can take place through wage reduction, increases in the length or intensity of the working day, and through technical change. The latter becomes the central means over the long run. In this context, individual capitals make their decisions based on judgments in the face of an intrinsically indeterminate future, one that remains to be constructed. Competition pits seller against seller, seller against buyer, and buyer against buyer […] It operates not only on prices and profits but also on wages and rents. Profit is the excess of price over operating costs, and no capital is assured of any profit at all, let alone the „normal“ rate of profit […] the relevant profit must be that which is defensible in the medium term, which is quite different from the notion of short-term maximum profit emphasized in neoclassical theory […] firms set prices in light of market conditions and competitive consequences, cutting these prices in order to gain an advantage over their existing competitors and to keep potential ones at bay.
Except for distress sales, price cuts are ultimately limited by costs […] However, luring more customers to your door with lower prices is of little benefit unless you can increase your normal level of production. The advantage therefore resides in the lowest cost reproducible conditions of production […] The regulating capitals are therefore also the price-leaders in an industry. Their price becomes the benchmark for market prices. It follows that non-regulating capitals will be price-followers, and since they must adapt their own selling prices to those of the price-leaders, their profits are residuals“ (Shaik 2016, S. 259-260 und 268; siehe die übersichtliche Tabelle der Wettbewerbseigenschaften innerhalb und zwischen Branchen auf S. 271 mit zusätzlichen, hier nicht angeführten Eigenschaften und die empirischen Evidenzen seines Ansatzes auf den S. 272-326).
Ein solches Wettbewerbskonzept dürfte nach dem hermeneutischen Eindruck des Verfassers dieser Zeilen trotz der eventuell leichten Überbetonung des Aspekts der Kostenreduktion und der Ausblendung anderer Dimensionen (z.B. der Werbung) eine im Vergleich zu Varian realistischere Darstellung des wirtschaftlichen Alltags sein. Varians Kapitel 1 ist im Vergleich z.B. zu Pindyck/Rubinfeld (2015) abstrakter und in gewissem Sinne noch näher am Mainstream (I) anhand seines idealtypischen Beispiels, da in Pindyck/Rubinfelds Kapitel 1 bspw. auch Nichtwettbewerbsmärkte angesprochen werden. Hinsichtlich der ideologischen Implikationen und Verallgemeinerungen ihrer pro-Markt-Ausführungen liegen die Autoren beider LB aber auf der gleichen Linie.
Diese Linie zeichnet sich auch dadurch aus, dass auch in den folgenden Kapiteln wie selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass immer eine Gleichgewichtsposition bestehen muss. Warum aber sollte dies immer der Fall sein?
► Literaturangaben
► Mehr aus dieser Studie